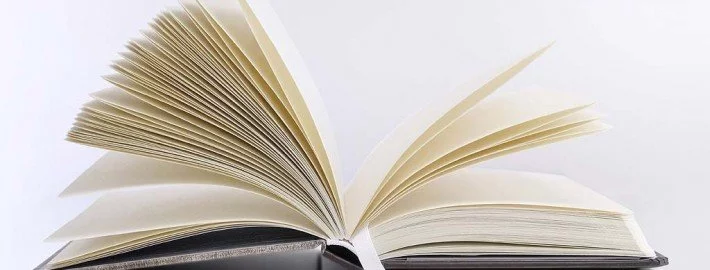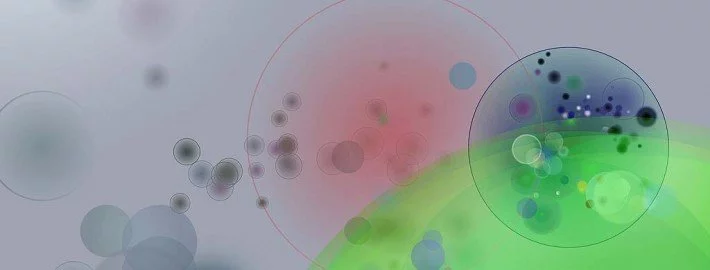Warum Freundschaften wichtig für unser Wohlbefinden sind Ausreden gibt es genug: Der anspruchsvolle und zeitaufwendige Job oder Familienverpflichtungen müssen oft herhalten, um vor sich und anderen zu rechtfertigen, warum man denn seine sozialen Kontakte nicht regelmäßig pflegt. Dass gerade dies jedoch entscheidende Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann, wurde bereits durch mehrere Studien belegt. Zum einen verändert […]
Schlagwortarchiv für: Psyche
Du bist hier: Home » Psyche
Beiträge
Der Hashtag #notjustsad versammelt zahlreiche Erlebnisberichte von psychisch kranken Menschen, die sich über ihre Erfahrungen mit ihrer Krankheit und auch mit der Begegnung mit ihrer Umwelt austauschen. Der Titel notjustsad drückt bereits aus wie schwierig die Beziehung von Gesellschaft und psychischen Leiden immer noch ist. Physische Krankheiten finden nach wie vor mehr Anerkennung und Verständnis […]
Die DGPPN, die deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, hat eine neue Leitlinie herausgebracht. Darin geht es um Menschen mit schweren und langwierigen psychischen Störungen und die Möglichkeiten, die mehr Integration ins Arbeitsleben für sie bieten. Die Situation Knapp 40% der Europäer sind laut aktuellen Studien mehr oder minder stark von psychischen Krankheiten betroffen: […]
Wie gestalt jemand sein Leben, der durch besondere individuelle körperliche und geistige Gegebenheiten einen ganz anderen Zugang zur Welt als die meisten seiner Mitmenschen hat? Für viele psychisch kranke Menschen oder solche, die mit den Spätfolgen einer psychischen Störung leben müssen, sind diese Fragen elementar. Eine Möglichkeit diese Schicksale zu mildern und sie an ein […]
Seit einigen Jahren wird immer häufiger von ausgelaugten, erschöpften Studenten und dem ansteigenden Konkurrenzdruck an den deutschen und auch ausländischen Universitäten berichtet. Straffere Lehrpläne, umfangreichere Prüfungen und weniger Zeit zum Studieren führen bei so manchem Studenten zu Erschöpfungszuständen, welche die Gesundheit und Psyche immens belasten. Dazu kommt nicht selten Zukunftsangst und finanzielle Belastungen, die sich […]
Was normal ist oder nicht, bestimmt die Statistik, denn normal ist, was dem Zustand oder dem Verhalten der Mehrheit entspricht. Ob davon abweichende Zustände und Verhaltensweisen aber als „psychisch krank“ definiert werden wird oft von der „DSM“ bestimmt. Hiermit ist das von der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung herausgegebene „Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders“ gemeint (zu […]
Stress belastet die Seele. Darüber sind sich seit jeher Psychologen einig. Das Leben in der Großstadt kann daher belastender sein als auf dem Land, wo weniger Stau herrscht, der Alltagslärm wesentlich geringer ist und die Alltagshektik noch nicht in einem ausgeprägten Maß Einzug gefunden hat. Natürlich bietet das Leben in der Stadt auch zahlreiche Vorteile. […]
Menschen können von Mäusen lernen – auch dies ist eine Erkenntnis aus der Forschung nach dem Zusammenhang von einer bestimmten psychischen Erkrankung mit einem Fehler im Immunsystem. Es handelt sich dabei um eine Zwangsstörung, die dazu führt, sich die Haare auszureißen. Lange wusste man nicht, dass dieses Verhalten einer körperlichen Ursache zugrunde liegt. Nun erlangte […]
Wirtschaftskrise in Spanien – Depressionen und Selbstmord als Folge Die Wirtschaftskrise in Spanien führt laut neuesten Studien zu psychischen Folgen für die spanische Bevölkerung. Immer wieder wird über den Anstieg von Suizidfällen berichtet. Inzwischen wurde der Zusammenhang zwischen der Krise und den psychischen Ausnahmefällen analysiert. Die Menschen in Spanien sind arm. Arbeitslosigkeit und Geldnot beherrschen […]
Psychische Störungen werden von vielen Teilnehmern der Gesellschaft als Garant für Andersartigkeit in jeder Hinsicht verstanden. Betroffene werden als „merkwürdig“ und „komisch“ eingestuft und natürlich bringen psychische Störungen einschneidende Veränderungen für den Erkrankten und sein Umfeld mit sich. Betrachtet man allerdings die Liste jener Künstler und kreativen Köpfe, die an einer psychischen Störung gelitten haben und […]
Viele von uns werden im Frühjahr von Heuschnupfen und weiteren Auswirkungen von Pollenallergien geplagt. Es gibt inzwischen zahlreiche Formen von allergischen Reaktionen. Ob auf Hausstaub, Milben, Tierhaare oder Lebensmittel: unser Körper wehrt sich des öfteren gegen bestimmte Allergene. Diese Abwehrreaktion kann sich in Form von Niesen, Hautausschlag aber auch Atemnot äußern. Forscher haben nun den […]
Die Diagnose Krebs verändert das Leben eines Betroffenen ganz immens und auch das seiner Angehörigen. Krankenhausbesuche, Chemotherapien und schwere Nebenwirkungen sind nur eine Reihe von belastenden Faktoren, die einem Krebspatienten das Leben buchstäblich erschweren. Gar nicht erst zu sprechen von einem Todesfall durch Krebs. Psychoonkologen sind jene Menschen, die Betroffenen in jeder Hinsicht zur Seite […]
Aus dem Klang und der Intonation eines Sprechers lässt sich viel heraushören. In der Regel kann man an der Stimme feststellen, wie das Gegenüber gelaunt ist oder ob sie oder er gerade hektisch ist. Menschen erkennen beispielsweise auch am Klang, ob das Gegenüber am Telefon lächelt oder nicht. Die Stimme ist Spiegel der Seele Das sagt Walter […]
Wenn wir von Macht sprechen, assoziieren wir damit meist eine negative Definition des Begriffs. Macht begegnet uns allen ständig: ob im Beruf, in der Beziehung oder Ehe oder in der Politik. Wir Menschen sind fortwährend Machtsituationen ausgesetzt. Doch wieso empfinden wir Macht generell als negativ? Welche Formen von Macht gibt es eigentlich und wann ist […]
Als Folie á deux wird in der Fachsprache eine Geistesstörung zu zweit beschrieben. Diese gemeinsame psychotische Absonderlichkeit wird auch als induzierte wahnhafte Störung bezeichnet. Man versteht darunter die psychotische Ansteckung eines an sich gesunden, aber meist eher labilen Menschen durch einen, an einer Psychose erkrankten. In der Regel handelt es sich dabei um Verwandte oder Lebenspartner. Meist spielt sich […]
Der Sommer ist da – und nachdem er sich zunächst ebenso zu verspäten schien wie das Frühjahr, erwarten manche Meteorologen nun sogar rekordverdächtige Sonnenpräsenz. Das sollte man unbedingt nutzen! Sonnenlicht ist für uns Menschen wie für die größte Zahl der uns bislang zugänglichen Organismen von enormer Bedeutung. Wie erst vor wenigen Jahren erforscht wurde, besitzen wir in unseren […]
Jungs sind anfälliger für psychische Leiden. Doch für welche? Der neue „Männergesundheitsbericht 2013“ der Stiftung Männergesundheit und der Deutschen Krankenversicherung GKV befasst sich nicht nur mit den Missständen der gesundheitlichen Versorgung von Erwachsenen Männern, sondern auch denen in der Versorgung und Behandlung von Jungen. Der Fokus, welcher auf die psychischen Erkrankungen gesetzt wurde, liefert hier einige […]
Ein jeder Mensch betrachtet seine Umwelt auf eine individuelle Art und Weise. Die Diskrepanz zwischen Wahrnehmungen zeigt sich am deutlichsten, wenn Menschen an psychischen Krankheiten leiden. Hochsensibilität ist zwar keine psychische Krankheit, aber sie verändert die Sichtweise auf das Leben. Geräusche, Gerüche und generell Sinneseindrücke werden von hochsensiblen Menschen ohne Filter wahrgenommen, sodass sie manchmal […]
Es wurde vielfach darüber berichtet, dass vor allen Dingen Jungs im Bereich der psychischen Erkrankungen durch ein Raster fallen, das psychische Störungen mit Schwäche gleichsetzt. Dieses Stigma empfinden viele Menschen noch immer und besonders bei Jungs oder Männern scheint der Gedanke verhaftet zu sein, dass psychische Probleme ein Eingeständnis eines Fehlers gleichkommt. Der Männergesundheitsbericht 2013, […]
In der Moderne verlieren Menschen schnell die Geduld. Der Alltag ist hektisch und alles muss so schnell wie möglich erledigt werden. Warten kann kaum noch jemand. Und doch: Ungeduld hat negative Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit. Daher ist es wichtig, dass Geduld gelernt wird, um die negativen Folgen zu vermeiden. Negative Auswirkungen der […]