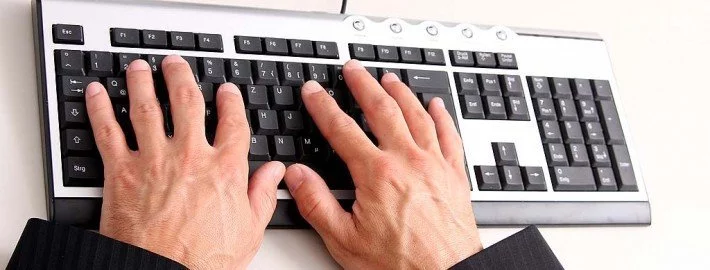Heutzutage wird der schmale Grat zwischen dem, was man „Normalität“ nennt und Geisteskrankheiten immer ungenauer. Häufiger denn je wird Alles, was anders erscheint, als krank definiert. Psychische Störungen werden anhand von Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und des amerikanischen DSM-5 diagnostiziert. Am Beispiel der Krankheit Schizophrenie lässt sich zeigen wie Krankheit und Normalität enggeführt werden. Die psychische […]
Schlagwortarchiv für: Schizophrenie
Du bist hier: Home » Schizophrenie
Beiträge
Schizophrenie gehört zu den endogenen Psychosen und ist eine gravierende psychische Erkrankung. Psychosen fassen allgemein Krankheitsbilder wie Wahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt zusammen. Endogen bedeutet, dass die Krankheit im Inneren entsteht und nicht mit äußeren Erlebnissen zusammenhängt. Charakteristisch für schizophrene Erkrankungen sind Störungen des Denkens und Wahrnehmens sowie inadäquate und verflachte […]
Warum sich eine Schizophrenie entwickelt, ist bis heute nicht endgültig geklärt. Bekannt ist aber schon länger, dass im Gegensatz zum Tier, nur Menschen schizophren werden können. Wissenschaftler können nun auch sagen, warum dieser Unterschied besteht. Schwerwiegende Veränderungen Eine Schizophrenie tritt im Laufe des Lebens bei rund einem Prozent der Bevölkerung auf. Eine Erklärung für die […]
In der Medizin wird die katatone Schizophrenie als eine seltene Form der Schizophrenie bezeichnet. Die Betroffenen leiden dabei unter einer Störung der Psychomotorik. Im Volksmund wird die Schizophrenie auch “Wahnsinn” genannt. Im Verlauf der Krankheit kommt es zu extremen Beeinträchtigungen der menschlichen Persönlichkeit. Dazu gehören auch Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Die Symptome, die im Rahmen einer […]
Frauen leiden öfter als Männer unter psychischen Beschwerden, Männer hingegen probieren ihre Probleme teilweise anders zu lösen, wie beispielsweise durch gesteigerten Alkoholkonsum oder zeigen andere Verhaltensweisen auf. Kann man denn nun von typischen Mustern bei Verhaltensstörungen sprechen, die entweder Frauen oder nur Männer betreffen? Verhaltensstörungen Gegen Ende des 19ten Jahrhunderts gab es in Europa unglaublich viele […]
Kennen Sie den Film „A beautiful mind“ mit Russell Crowe? Sehr sehenswert. Er zeigt die Lebensgeschichte des insbesondere für die Spieltheorie bekannten Mathematikers John Forbes Nash Jr. Während seines Studiums wird bei ihm Schizophrenie diagnostiziert, die ihn immer tiefer in den Wahn führt, dass er in geheimem Auftrag der amerikanischen Regierung Codes sowjetischer Agenten entschlüssele. Nash wird […]
Auch heute noch fühlen sich viele psychisch kranke Menschen stigmatisiert. Dies ruft bei ihnen Scham und das Gefühl von Schwäche hervor. Burnout-Patienten und Depressive fühlen sich oft als Versager und fürchten, von ihrer Umwelt als Mimosen oder „Waschlappen“ wahrgenommen zu werden. Oft sind diese Ängste jedoch unbegründet und das soziale Umfeld reagiert verständnisvoller als gedacht. […]
Das Krankheitsbild der Schizophrenie zeichnet sich durch sein vielfältiges und komplexes Erscheinungsbild aus. Die Krankheitsphasen unterscheiden sich durch akute und chronische Phasen. Während einer akuten Schizophrenie treten Phänomene auf, die bei einem gesunden Menschen nicht zu beobachten sind. Dazu gehören etwa das Hören von Stimmen und ein auftretender Verfolgungswahn. Der Patient selbst empfindet sich nicht als krank, für ihn […]
Bei der hebephrenen Schizophrenie handelt es sich um eine besondere Form der Schizophrenie. Veränderungen werden bei dieser Krankheitsform im affektiven Bereich angesiedelt. Die Krankheit wird manchmal auch als Hebephrenie bezeichnet. In früheren Jahren wurde die hebephrene Schizophrenie als „Läppische Verblödung“ oder „Jugendirresein“ bezeichnet. Solche Dinge werden in der heutigen Zeit natürlich als unangemessen angesehen. Später, […]
Das sogenannte weiße Rauschen, das Schizophrenie-Patienten das Leben schwer macht, ist bislang noch nahezu unerforscht. Es deutet allerdings auf eine Überbelastung im Gehirn hin. Eine Studie hat sich diesem Symptom nun angenommen und hofft die psychische Erkrankung Schizophrenie dadurch verständlicher zu machen. Die Studie im Detail Die Forscher der Columbia University bezogen 36 Probanden in […]