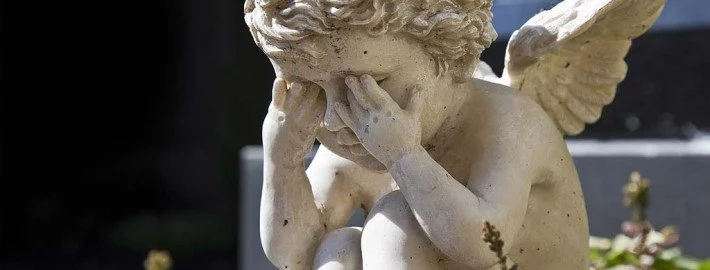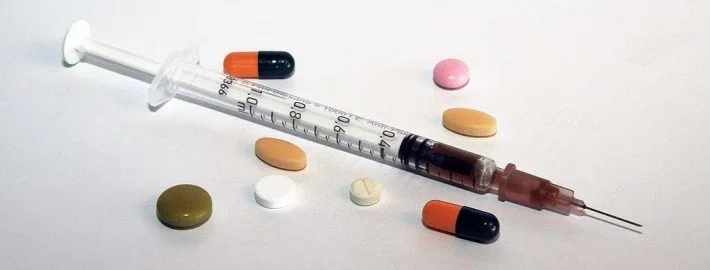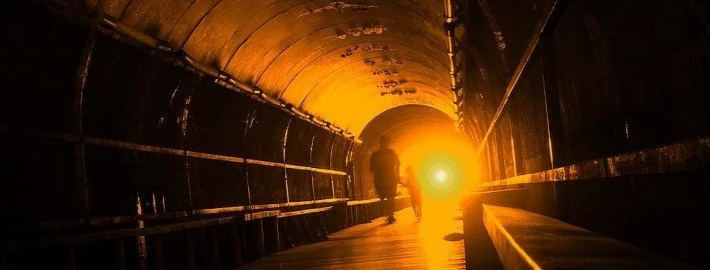Der Tod ist ein Aspekt des Lebens. Auch wenn Menschen ihn zuoft aus ihren Gedanken zu verdrängen versuchen, so gehört er dennoch unwiderruflich zu einem Lebensverlauf dazu. Viele Menschen haben allerdings keine Angst vor dem Tod selbst, sondern vielmehr vor dem Sterben und dem Sterbeprozess. An dieser Stelle setzt die Hospizarbeit ein und hilft den Menschen, die belastende Zeit […]
Schlagwortarchiv für: Tod
Du bist hier: Home » Tod
Beiträge
„Den Tod als Teil des Lebens akzeptieren“, „in Würde sterben“ oder „den Tod annehmen“ – dazu kann man in den Medien Artikel lesen, Sendungen sehen und Podcasts hören. Zahlreiche Bücher sind erschienen. Sterben wird teilweise als wunderbares, zu zelebrierendes Erlebnis geschildert. Doch die Realität ist eine ganz andere. Was versteht man unter Palliativmedizin? Palliativmedizin kann entsprechend […]
Hatten Sie den Gedanken auch schon mal? Natürlich nur in rabenschwarzen Momenten! Dem Ex-Mann einen gedungenen Killer hinterherschicken oder dem Chef? Nein, nicht ernsthaft natürlich. Unwillkürlich denkt man an die Mafia und die Cosa Nostra. Man kennt das ja aus Gangsterfilmen, Krimis und schlechten Soaps aus dem Fernsehen. Und zwischendurch liest man es mal in […]
Weltweit begehen jährlich mehr als 800.000 Menschen Selbstmord. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weit höher liegen, da viele Selbstmorde als Unfälle in die Todesursachenstatistik eingehen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht nun ihren ersten Bericht zur Suizidprävention und möchte diesen als einen Aufruf verstehen, dieses große Problem der öffentlichen Gesundheit anzugehen. Daten Daten und Erfahrungen aus Nordamerika, […]
Der zum Tod durch Giftspritze verurteilte Mörder Ricky Ray Rector aß nur einen Teil seiner Henkersmahlzeit. Den Rest wollte er sich für später aufheben. Angel Nieves Diaz, 55, aus Florida, verurteilt wegen Mords, Entführung und bewaffneten Raubs, lehnte eine letzte Mahlzeit ab. Er sollte das normale Gefängnisessen bekommen, lehnte aber auch das ab. Das passt zu […]
Nur die wenigsten Menschen setzen sich bewusst und aktiv in ihrem Alltag mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit auseinander. Das kommt nicht von ungefähr, denn beide Themen entziehen sich unserem Einflussbereich und lösen so potentiellen psychischen Stress aus. Vor allem setzen uns aber die subtilen Erinnerung an diesen Themenkomplex zu, etwa durch zufällig mitangehörte Gespräche […]
Der Tod, so heißt es, ist das letzte Tabu unserer Gesellschaft. Tatsächlich weichen die meisten Menschen dem Gedanken an das Lebensende aus. Wie das Fachmagazin „Psychologie heute“ berichtet, provoziert ein plötzliches „Memento Mori“, eine Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, eine ganze Reihe von Reaktionen in uns. So lässt uns die Konfrontation mit dem Tod kurzfristig anhänglicher werden, wir […]
Wir erklären Dir verschiedene Aspekte des Todes im Bezug zur Psychologie, Biologie, Medizin und Soziologie. Des Weiteren erfährst Du, wie, warum und weshalb Menschen sterben. Wodurch stirbt der Mensch eigentlich? Da Mensch aus Zellen besteht und diese mit der Zeit altern, ist es logisch, dass wir irgendwann sterben. Im Laufe der Zeit fangen manche Mechanismen […]
Vor nicht allzu langer Zeit schockierte uns der Drogentod der britischen Soulsängerin Amy Winehouse. Die Liste ist lang: Chet Baker, Heath Ledger, Janis Joplin, Kurt Cobain, John Belushi, Whitney Houston, um nur einige zu nennen. “I’m so high that I might die” rappte Eminem in “Drug Ballad”. Und jetzt der Schauspieler Philip Seymour Hoffmann. In den Medien war […]
Souvenirs können beim Trauern helfen, vor allem Individuelle. Um den Hinterbliebenen das Trauern zu erleichtern, gestalten zwei Hamburgerinnen individuelle Souvenirs. Diese Souvenirs werden speziell für die Verstorbenen angefertigt und sind ein ganz besonderes Erinnerungsstück. Nach einem Todesfall steht oftmals alles still. Es gibt allerdings einige Sachen, die erledigt werden müssen. Es muss ein Sarg ausgesucht […]
Belgische Forscher haben innerhalb einer Studie herausgefunden, dass Nahtod-Erfahrungen eine ganz eigene Realität aufweisen. Denn innerhalb dieser Erlebnisse schildern Betroffene oftmals neue Eindrücke von vergangenen Begebenheiten – die tatsächlich stattfanden. Während einem Nahtod-Erlebnis sind diese Erinnerungen extrem lebendig und voller Details. Dieses Phänomen wollten die Forscher genauer ergründen und wählten daher einen vollkommen neuen Ansatz. […]
Wer den Verlust eines geliebten Menschen erlebt, fühlt sich meist hilflos. Allerdings können, der Glaube an das Schicksal und seine Bestimmungskraft, bei der Überwindung der Trauer helfen. Zu diesem Ergebnis kamen Psychologen aus Mainz und Münster aufgrund einer neunjährigen Studie. Der Tod als das einschneidenste Erlebnis Die Wissenschaftler der Unis in Mainz und Münster haben sich über neun Jahre […]
Heutzutage kommt es viel häufiger vor als wir denken, dass beim Tod eines geliebten Freundes die Hinterbliebenen in sozialen Netzwerken wie etwa auf Facebook den Austausch miteinander intensivieren. Freunde und Bekannte des Verstorbenen versuchen auf diese Art und Weise den Verlust langfristig auszugleichen. Bei einem Trauerfall rücken Freunde meist deutlich enger zusammen. Es braucht Zeit den […]
Mord oder humanes Handeln? Sterbehilfe ist in Deutschland umstritten. Während einige Menschen das Vorantreiben des Sterbevorgangs befürworten, lehnen Gegner die Sterbehilfe strikt ab. Beide Seiten haben trifftige Gründe für ihre Meinung. Die Parteien argumentieren teilweise losgelöst von der Situation, in der sich Betroffene befinden und für einige Menschen ist es vorallem eine ethische Frage. Tatsächlich finden sich […]
Der Mensch und sein Leben zeichnen sich durch Endlichkeit aus. Uns ist bewusst, dass unser Leben nicht ewig währt. Aus diesem Grund sind Aussprüche wie „Carpe diem“ so beliebt, denn sie rühren an der Tatsache, dass wir nicht ewig Zeit haben unser Leben so zu leben, wie wir es uns wünschen. Was macht die Tatsache […]
Wer sich die Todesanzeigen in seiner Tageszeitung näher ansieht, dem fällt sicher auf, dass Ehe- oder Lebenspartner oftmals kurz hintereinander versterben. Dieses Phänomen ist nicht neu, dennoch konnte die Wissenschaft bis heute die Ursache dafür nicht entschlüsseln. Es existieren eine ganze Reihe von Theorien darüber, eine schlüssige Erklärung gibt es jedoch bis heute nicht. Der Volksmund spricht hier gern […]