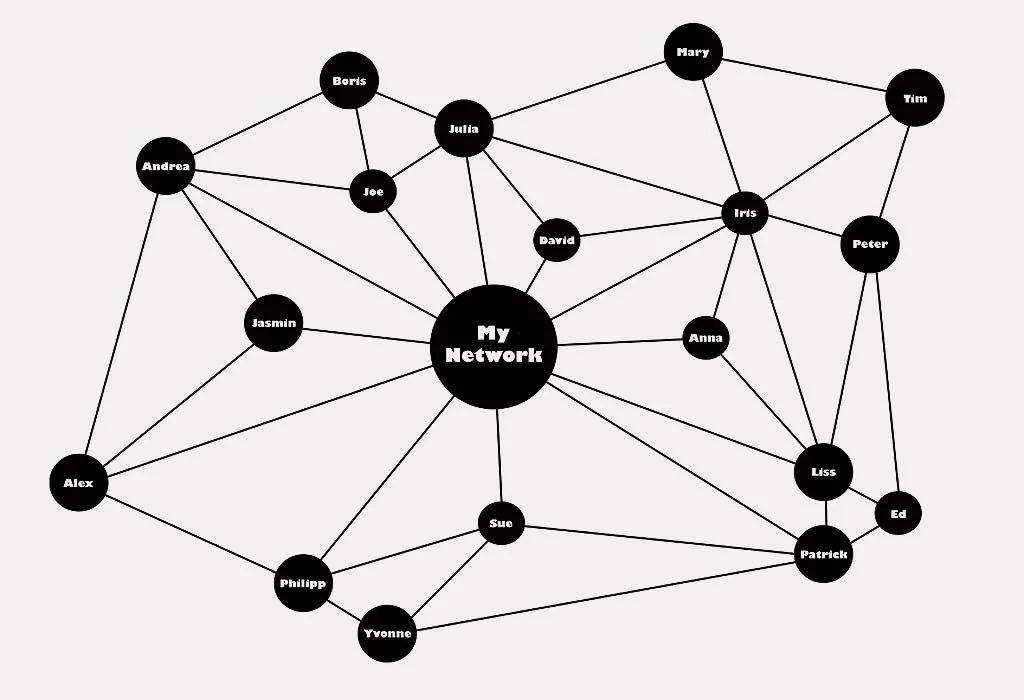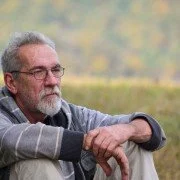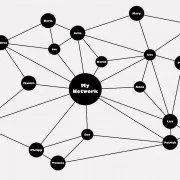Katze oder Hund? Antwort verrät Charaktereigenschaften der Tierfreunde
Die Antwort auf die Frage spaltet so manche Tierfreunde schon immer in zwei Lager. Jedoch ist vielen nicht bewusst, dass die Antwort auch so einiges über den eigenen Charakter aussagen kann. In Deutschland leben zurzeit rund 13 Millionen Katzen als Haustiere. Auch im Internet gehören sie zu den beliebtesten Tieren. Es gibt unzählige süße und lustige Videos über die kleinen Samtpfoten. Hunde gibt es in Deutschland auch unglaublich viele. Knapp 8 Millionen Hunde halten wir Deutsche als Haustiere.
Tierfreunde beachten, Haltung beider Tiere ist sehr unterschiedlich
Die meisten Hunde sind extrem loyal und gehorsam. Zudem gelten sie als sehr vertrauensselig. Katzen sind da meistens ganz anders. Sie sind vor allem für ihre Unabhängigkeit und für ihren Dickkopf bekannt. Deshalb sagt man auch oft, dass Hunde Herrchen haben und Katzen Personal. Das deutet natürlich darauf hin, dass Katzen- und Hundeliebhaber auch sehr unterschiedlich sein können. Sogar Menschen, die gar kein Haustier besitzen, können meistens über sich selbst sagen, ob sie eher ein Hunde- oder Katzentyp sind.
Nun bleibt die Frage, ob man die Tierfans anhand ihres Charakters wirklich in solche zwei Gruppen aufteilen kann. Zudem fragen sich Wissenschaftler, wie deutlich die Unterschiede zwischen den zwei Gruppen sind.
Es gab schon viele Studien, die diese Fragen untersucht haben. Ein einheitliches Ergebnis kam da bisher noch nicht raus. Die eine Studie entdeckt, dass Hundeliebhaber aggressiver sind als Katzenfreunde, die andere Studie entdeckt das genaue Gegenteil. Einige Untersuchungen haben sogar keinen Zusammenhang zwischen unserer Persönlichkeit und unserer Vorliebe für bestimmte Haustiere gefunden.
Ein Psychologen-Team geht nun davon aus, dass die unklaren Ergebnisse auf Grund von zahlreichen methodischen Problemen in den Studien zu Stande gekommen sind. Ältere Studien haben sich nur auf sehr kleine Stichproben bezogen. Zudem waren die Stichproben nicht sonderlich divers. Außerdem hat man die ganzen Studien auf so unglaublich viele verschiedene Persönlichkeitsmerkmale bezogen, dass ein einheitliches Bild kaum möglich ist. Die meisten Studien untersuchten ein breites Spektrum an relativ zufällig gewählten Charaktereigenschaften wie zum Beispiel Maskulinität und Femininität, Unabhängigkeit, Dominanz oder Sportlichkeit von Teilnehmern.
Deshalb untersuchte der Psychologe Manuel Gosling und sein Team im Jahre 2010 mehr als 4500 Probanden. Um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen, wendeten sie das Fünf-Faktoren-Modell an. Dieses Modell wendet man inzwischen bei jeder Persönlichkeitsforschung an. Es ist in der Lage, den Charakter eines Menschen anhand von Werten auf fünf Skalen zu beschreiben. Diese fünf Skalen sind Offenheit für neue Erfahrungen, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Neurotizismus.
Hundefreunde sind verträglich und Katzenliebhaber offen
Die Menschen, die von sich selbst behaupten, dass sie Hundemenschen sind, erwiesen sich im Persönlichkeitstest eher als extravertierter, gewissenhafter und verträglicher. Das bedeutet, dass sie geselliger, zuverlässiger, verständnisvoller und hilfsbereiter sind. Personen, die sich als Katzenmenschen bezeichnen, erzielten bei dem Test dagegen höhere Werte in den Punkten Offenheit und Neurotizismus. Das heißt, dass sie im Durchschnitt fantasievoller und experimentierfreudiger sind. Zudem neigen sie dazu, Werte und Normen kritisch zu hinterfragen. Allerdings werden sie auch stärker von einigen negativen Emotionen wie Unsicherheit und Angst geplagt.
Experten gehen stark davon aus, dass wir uns zu Tieren angezogen fühlen, die uns ähneln. An den Ergebnissen der Studie kann also durchaus was dran sein.