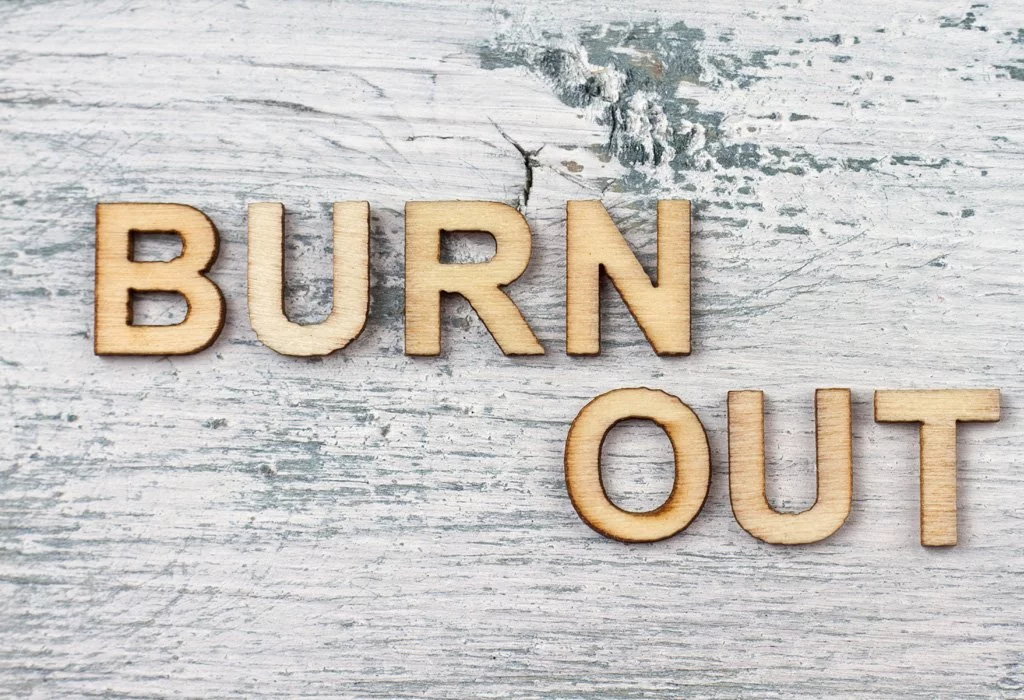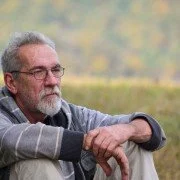Linkshänder: Rückschulungen helfen auch im Alter
Früher war es an der Tagesordnung Linkshänder in der Schule auf die rechte Hand umzuschulen. Alle Kinder sollten mit der „richtigen“ Hand schreiben. Heute weiß man, dass die Nutzung der rechten Hand nachteilige Folgen für die betroffenen Linkshänder hat. Insofern sollen Rückschulungen auf die ursprünglich starke linke Hand auch noch im Alter Vorteile haben.
Die Psychologin Marina Neumann wurde vor ca. 20 Jahren durch einen Bericht auf die Möglichkeit der Rückschulung aufmerksam. Sie entwickelte selbst ein Konzept, mit dem sie sich peu à peu wieder auf Links umstellte. Damit fiel eine große Last von ihr ab. Sie hat daraufhin diese Erfahrung zu ihrer Berufung gemacht. Inzwischen ist sie spezialisiert auf die Rückschulung von Menschen jeden Alters.
Linkshänder: Umschulung bis in die 1990er Jahre gängig
Es ist unglaublich, aber die Umstellung von Linkshändern war noch bis in die 1990er Jahre üblich. Aktuell sehen Fachleute der „Ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder“ ein anderes Problem. Linkshänder-Kinder versuchen, ihre Rechtshänder-Freunde nachzuahmen. Hier besteht die Gefahr der selbstständigen Umschulung auf die rechte Hand.
Umschulung in islamisch geprägten Ländern üblich
Ein weiteres Problem liegt in der Anschauung islamischer Länder, welche die linke Hand als „unrein“ ansehen. Es ist untersagt, mit der linken Hand zu schreiben oder zu essen. Aus diesem Grunde ist eine Umschulung auf die rechte Hand dort üblich. Viele Pädagogen haben außerdem zu wenig Grundwissen zur Erkennung und Förderung von Linkshändigkeit.
Es ist unklar, wie hoch der Anteil der Linkshänder ist, da die Zahlen sehr stark schwanken. Doch wie kommt die Veranlagung eigentlich zustande? Die Leiterin der o. g. Beratungsstelle geht davon aus, dass die Genetik für Linkshändigkeit verantwortlich ist. Linkshänder verfügen über eine stärkere Ausprägung der rechten Hirnhälfte, bei Rechtshändern ist die anders herum. Die zwangsweise stärkere Nutzung der „schwächeren“ Hirnhälfte kann sogar zu psychischen Problemen führen. Es ist im Grunde ein schwerwiegender Eingriff in die Funktion des menschlichen Gehirns und man sollte sich sehr gut überlegen, ob so etwas tatsächlich notwendig ist.
Die Folgen der Umschulung
Durch die Umschulung hervorgerufene psychische Folgen sind z. B. Probleme mit dem Gedächtnis oder der Konzentration. Desweiteren können Störungen beim Erkennen von Links und Rechts oder Rechtschreibprobleme auftreten. Schließlich sind auch Sprachstörungen oder Defizite in der Feinmotorik möglich. Durch diese Dinge werden zum Teil Folgeschäden ausgelöst, wie beispielsweise Introvertiertheit, Depressionen oder Verhaltensstörungen.
Der 13. August wurde zum Tag des Linkshänders bestimmt. Es soll über die Linkshändigkeit aufgeklärt werden, Probleme bekannt gemacht und Toleranz gebeten werden.
Rückgeschulte Menschen empfinden dies als Erleichterung. Sie werden entspannter und zufriedener. So können Rückschulungen zu fundamentalen Änderungen des Lebens führen. Auf einmal ist diesen Menschen klar, was sie möchten und was sie glücklich macht. Die Konzentration verbessert sich und die Leistungsfähigkeit steigt an. Die neue Ruhe ist außerdem zielführend.
Die Rückschulung ist aber nicht in allen Fällen die Lösung. So kann sie Menschen mit Epilepsie oder Multipler Sklerose z. B. eher schaden. Auch sind Rückschulungen nicht immer von Erfolg gekrönt. Es empfiehlt sich außerdem eine begleitende Psychotherapie während der Rückschulungsphase.
Auf jeden Fall kann die Rückschulung auf die linke Hand in vielen Fällen eine gravierende Verbesserung der Lebensumstände mit sich bringen. Einzelfälle gibt es wohl immer, bei denen eher abzuraten ist. Wichtig ist, dass sich Betroffene Zeit für die Umstellung nehmen, um bestmöglichen Erfolg zu erzielen.