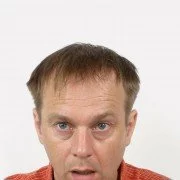Kooperatives Verhalten vorteilhaft: Sterben für andere?
Sein Leben für andere geben. Was steckt hinter einer solchen Bereitschaft? Ein wichtiger Faktor ist das gemeinsame Erleben schrecklicher Erfahrungen, was die Beteiligten, auch nicht verwandte Menschen, zusammenschweißen lässt. Menschen sind soziale Wesen. Einer Gruppe anzugehören hat sich schnell als überlebenswichtig erwiesen. Auch das kooperative Verhalten innerhalb der Verwandtschaft und der Gruppe zeigte sich im Laufe der Zeit als äußerst vorteilhaft. Die Bereitschaft zum Wohl Anderer, auch nicht verwandten Gruppenmitglieder, zu sterben, konnte bisher jedoch noch nicht erklärt werden. Ein mathematisches Modell soll helfen.
Das kooperative Verhalten: Womit sich identifiziert wird
Dafür ist ein zusätzlicher Faktor notwendig. Durch gemeinsam schmerzlich durchlebte Erfahrungen prägt sich eine starke Identifikation des Einzelnen mit seiner Gruppe aus, was zu einer extremen Opferbereitschaft bis hin zum Tode führe. Mehrere Zusammenhänge die aus dem Modell abgeleitet wurden, zeigten sich auch in Studien bezüglich Fußballfans, Burschenschaften, Kriegsveteranen und ähnlichen Gruppen. Für eine Gruppe kämpfen und Sterben zu wollen könne sich, so die Ansicht von Anthropologen und Psychologen im Fachblatt „Scientific Reports“, durch die Entwicklung des Verhaltens und weniger durch die Einflüsse aus kultureller Sicht entstanden sein. Solche Schlussfolgerungen könnten womöglich bei der Erklärung des Verhaltens von Mitgliedern von Verbrecherorganisationen, gewaltbereiten Sekten und Selbstmordattentäter behilflich sein.
Einsicht in ein mögliches Modell
Werden negative Erfahrungen gemeinsam erlebt, könne dies bewirken, dass sich die Individuen sogar enger miteinander verbunden fühlen als Brüder, laut Aussage von Sergey Gavrilets an der University of Tennessee in Knoxville.
Die mathematisch simulierten Abläufe sollten die Lebensbedingungen unserer Vorfahren verdeutlichen. Dabei wurden Gruppen von Jägern und Sammlern jeweils unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt, die drohten deren Gemeinschaft zu zerstören, seien es feindlich konkurrierende Menschengruppen in Bezug zu Nahrung und Lebensraum oder sich ändernde Umweltbedingungen. Weiterer Ausgangspunkt stellt das Leben der einzelnen Parteien in gleich großen Verbänden dar. In den einzelnen Situationen war das Überleben der Gruppe wichtiger als das, der naheliegenden Verwandten zu sichern. Die Aktionen der kompletten Gemeinschaft, das Mitwirken der Einzelnen und die darauf erfolgten Konsequenzen wirkten sich in dem Modell über mehrere Generationen auf das Überleben der Gruppe aus.
Vorteilhaft für die Gruppe im Modell war ein Verhalten, welches den Opfertod einiger Mitglieder bei großer Gefahr in Kauf nahm. Vorausgesetzt, dass eine gemeinsam durchlebte Not stattgefunden hat und sich das Mitglied danach vollständig mit der Gruppe identifizierte. Sonst wäre ein so extremes Kooperationsverhalten gar nicht möglich.
Bis in unsere Zeit
Unter bestimmten Bedingungen ist das Verhalten auch heute noch in einigen Strukturen zu finden. Beispielsweise unter sehr stark patriotisch eingestellten Menschen, in fundamentalistischen Religionsgemeinschaften oder bei Soldaten eines Einsatztrupps. Ist die Identifizierung mit der Gruppe so extrem stark, wird eine Bedrohung als persönlich aufgefasst und die Verteidigung der Gruppe, wie eine Selbstverteidigung angesehen.
Das Modell und einzelne Aspekte dieser Idee haben die Forscher noch auf andere Bereiche übertragen. So wurden in acht Einzelstudien das Muster unter Fans eines Fußballvereins aus England, in nationalistisch eingestellten US-Amerikanern, bei Kriegsveteranen und Mitgliedern einer Kampfsportgruppe gesucht. Jedoch seien noch weitere Studien nötig, um die Hypothese weiter zu bestätigen. Damit in Verbindung steht die Frage, ob die totale Identifizierung stärker wird, je kleiner die Gruppe ist. Zudem sollen zukünftig auch die kulturellen und traditionellen Faktoren mit einbezogen werden.