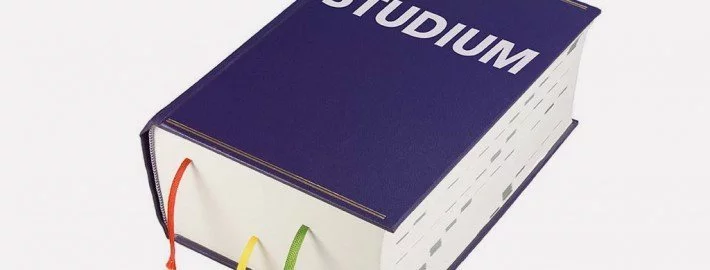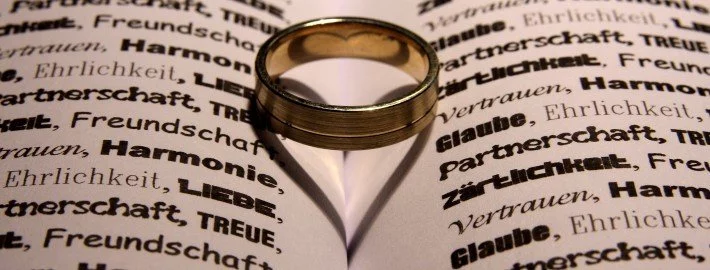Wer heute an deutschen Hochschulen Psychologie studiert, der tut dies in der Regel mit dem Ziel, einen Bachelor– oder Masterabschluss in diesem Fach zu erwerben. Die im Rahmen des sogenannten Bologna-Prozesses zur Vereinheitlichungen der Studienbedingungen in Europa eingeführten Studiengänge zeichnen sich durch ihren rigorosen Willen zur Verkürzung von Studienzeiten aus. So muss der Bachelor-Abschluss bereits […]
Schlagwortarchiv für: Psychologie
Du bist hier: Home » Psychologie
Beiträge
Immer mehr Menschen stehen offen dazu, wenn ihre Seele krankt. Dadurch findet die Psychotherapie auch immer mehr Zuspruch. Es wurde nahezu entstigmatisiert. Warum? Weil viele es schon selbst kennengelernt haben, sei es weil sie sich selber haben therapieren lassen oder weil sie jemanden in ihrem Umfeld haben oder hatten, der eine Psychotherapie gemacht hat. Im […]
Die Geschichte der Psychologie als Wissenschaft findet ihren Anfang im 19. Jahrhundert. Das erscheint erstaunlich, wenn man betrachtet, wie zahlreich und ausdifferenziert sich dieser Tage ihre Forschungsgebiete darstellen. Es wird jedoch leichter nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die heute von der Psychologie abgedeckten Themenbereiche bereits seit Jahrhunderten Gegenstand forschender Betrachtung sind – allerdings von anderen […]
Im Juli letzten Jahres sorgte ein Student der Universität Maryland für jede Menge Aufregung, als er eine Zusatzfrage auf Twitter postete, die ihm in seiner Abschlussprüfung in Psychologie begegnet war. Gestellt hatte die Frage Dr. Dylan Selterman, Dozent an der Psychologischen Fakultät der Universität. Die Frage Die Frage, die Selterman ans Ende der Klausur stellte, […]
Ein guter Lehrer hat nicht nur die Fähigkeit zur Pädagogik im Blut, sondern er hat vermutlich pädagogische Psychologie als Nebenfach studiert. Es ist nämlich kein Zufall, wenn Lehrer und Lehrerinnen einen guten Zugang zu ihren Schülern finden, sondern es steckt eine erlernbare Wissenschaft dahinter. Pädagogische Psychologie gehört als Teilgebiet zur Wissenschaft der Psychologie. Sie befasst […]
Der in Amerika hoch renommierte Psychiater Allen Frances packt aus – und zwar in seinem neuen Buch „Normal – Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen“. Der Akademiker spricht sich in seinem Werk gegen die „Krankschreibung“ gesunder Menschen aus, die im psychiatrischen Sektor immer häufiger wird und langsam sogar Überhand gewinnt. Immerhin erfüllen nach neusten Studien mittlerweile […]
Das Psychologie Studium hat den Menschen mit seinem Erleben und Verhalten zum Inhalt. Es geht in weiten Teilen um das Erkennen und Differenzieren von Standardverhalten und von abweichenden Verhaltensweisen, die eventuell sogar eine krankhafte Entwicklung zeigen können. Es gibt die Möglichkeit, einen Diplom-Studiengang zu belegen oder ein Bachelor- und Masterstudium zu wählen, die sich im […]
Liebe wird in der Wissenschaft der Seele, wofür der Begriff der Psychologie steht, meist durch die Art der Beziehung zwischen zwei Menschen definiert und analysiert. Die Art, wie sich Liebesbeziehungen gestalten, geht dabei in gewisser Weise noch auf Freud zurück, der die ersten „Objekt-Beziehungen“ des Individuums stark durch die Mutter beeinflusst sah. Inzwischen hat sich […]
Die moderne PSI-Forschung, ihre Ergebnisse und ihr Ansehen in der Gesellschaft Schlägt man im Deutschen Brockhaus unter dem Eintrag Parapsychologie nach, findet man die Definition: „… die (umstrittene) Lehre von den okkulten Erscheinungen, das heißt von außersinnlichen Wahrnehmungen (Telepathie, Hellsehen, Präkognition, Prophetie)… (…)“. An der zum Satzbeginn eingefügte Anmerkung „umstritten“, sowie der allgemeinen Klassifizierung ‚okkult‘ […]
Der berühmte Psychoanalytiker Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 in Mähren geboren. Seine Eltern waren der jüdische Kaufmann Jacob Freud und seine dritte Ehefrau Amalie. Freud sah sich sein Leben lang als religiös unabhängiger Mensch, trotzdem verlor er nie seine Beziehung zur Religion seiner Eltern. Er wurde von ihnen im Sinne der jüdisch-humanistischen Tradition erzogen. Dies […]
Psychologie & Telefonberatung Oft befinden wir uns in einer persönlichen Krise und haben nicht genügend Kraft und Energie, um selbst einen Weg aus einer Sackgasse herauszufinden. Probleme im Beruf, ständiger Stress mit einem Vorgesetzten, Ärger mit Kollegen, Streit in der Familie belasten und bereiten dem Betroffenen oft schlaflose Nächte. Man braucht eine einfühlsame Ansprechperson, die […]
Nachts arbeiten wir das auf, was uns tagsüber widerfahren ist. Traumforscher haben längst herausgefunden, dass unsere nächtlichen Träume viel mit dem zu tun haben, was wir erlebt haben und was uns beschäftigt. Uns selbst ist allerdings am Morgen nach dem Aufwachen oft nicht klar, was das nächtliche Durcheinander mit dem Tageserleben zu tun haben soll. […]
Zahlreiche Fernsehkrimis vermitteln ein völlig übertriebenes Klischee dieser Fachleute im Dienste der Verbrechensbekämpfung. Es ist daher Zeit, den Beruf des Kriminalpsychologen genauer vorzustellen und mit vielen Vorurteilen aufzuräumen. Was versteht man eigentlich unter Kriminalpsychologie? Die Kriminalpsychologie ist ein sehr wichtiger Teilbereich der Rechtspsychologie. Die Fachleute dort beschäftigen sich gleichzeitig mit Fragen, die sowohl der Psychologie […]