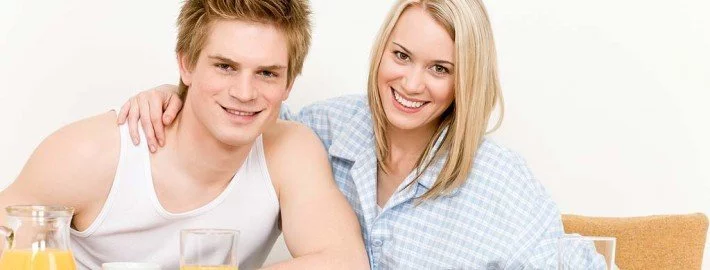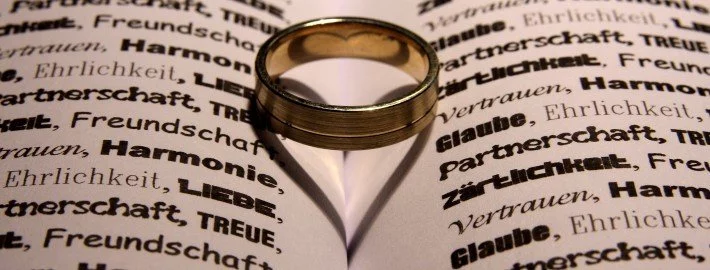Das Problem ist leider überhaupt nicht neu: Menschen nutzen den Wunsch anderer aus, eine Partnerin oder einen Partner fürs Leben zu finden. Das Gefühl der Einsamkeit und die Hoffnung, diesem Zustand zu entkommen, wird bereits seit Menschengedenken immer wieder von unredlichen Personen missbraucht, die sich zunächst das Vertrauen einer oder eines Anderen erschleichen und in […]
Schlagwortarchiv für: Liebe
Du bist hier: Home » Liebe
Beiträge
Angst in der Liebe ist ein weitverbreitetes Phänomen. Grundsätzlich gibt es viele unterschiedliche Angstformen und die Auslöser sind so verschieden wie die Menschen, die sich auf das Abenteuer Liebe einlassen. Dennoch lassen sich die gesamten Ängste auf wenige Arten zurückführen, die dann auch bestimmend für das Verhalten sein können. Verlustangst – Kindheit und Erwachsenenalter Eine […]
Jetzt ist es also wissenschaftlich bewiesen, was Frauen instinktiv ohnehin schon wussten: Bad Boys sind nichts zum Heiraten. Ein Team aus Psychologen machte dazu einen Test mit 289 männlichen Zwillingspaaren. Sie begleiteten die jungen Männer über einen Zeitraum von 12 Jahren und befragten sie dabei in regelmäßigen Abständen nach ihren Lebensgewohnheiten. Als Ergebnis ergab sich, […]
Die klassische Familie besteht aus Vater, Mutter und mindestens einem Kind. Im Verlauf der Zeiten haben sich allerdings viele weitere Beziehungsmodelle etabliert, die heute gängige Praxis sind. Die Zeiten, in denen geheiratet werden musste, um eine legitime Partnerschaft führen zu können, sind ebenfalls vorbei. Daher gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die an den jeweiligen Lebensstil […]
Ein Paar merkt, wenn eine einst glückliche Beziehung nur noch eine Qual ist. Die schönen Gefühle sind weitgehend verschwunden. Die beiden Partner leben wie in einer WG nebeneinander her. Das ist der Zeitpunkt, an dem ein Schlussstrich die beste Entscheidung ist. Viele Paare beenden die unglückliche Beziehung nicht. Zum einen ist es bequem, in der […]
Neurosen kommen heutzutage immer häufiger vor. Betroffene sind oft ängstlich, reizbar und verfügen über ein geringes Selbstbewusstsein und neigen zu Depressionen. Neurozitismus wird von Psychologen zu den fünf Grunddimensionen der Persönlichkeit gezählt. In einer Studie konnte nun gezeigt werden, dass Neurotiker sich während einer Liebesbeziehung emotional und im Bereich ihrer Persönlichkeit stabilisieren. Die Studie im Detail […]
Ihr Partner oder Ihre Partnerin führt ein Telefonat und Du weißt nicht genau mit wem? Achte hier unbedingt auf den Klang der Stimme. Denn dieser verändert sich, wenn wir mit einem Liebhaber sprechen – und dabei gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Solange Deine bessere Hälfte seine oder ihre Stimme während des Gesprächs […]
Meist verbindet man Abhängigkeit ja mit Drogen, Tabletten, Alkohol oder Tabak. Manchmal vielleicht auch noch mit Essen. Viel schwerwiegender ist aber die psychische Abhängigkeit vom Partner oder der Partner untereinander. Körper und Seele leiden, aber trotzdem kann man nicht loslassen? Emotionale Abhängigkeit ist weit verbreitet – und noch immer eher ein Tabuthema. Drei Stufen der […]
Fast jeder Mensch wünscht sich in seinem Leben einen Partner. Viele hoffen dabei auf die große Liebe und malen sich ihr Leben mit dem Partner aus. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: “Was ist Liebe eigentlich und wie entsteht sie?” Was ist Liebe? Liebe ist zunächst einmal eine Zuneigung von besonders hoher Intensität zu […]
Liebe wird in der Wissenschaft der Seele, wofür der Begriff der Psychologie steht, meist durch die Art der Beziehung zwischen zwei Menschen definiert und analysiert. Die Art, wie sich Liebesbeziehungen gestalten, geht dabei in gewisser Weise noch auf Freud zurück, der die ersten „Objekt-Beziehungen“ des Individuums stark durch die Mutter beeinflusst sah. Inzwischen hat sich […]
Das richtige tun für ein andauerndes Liebesglück in der Partnerschaft bedingt ein gewisses Mass an Psychologie und/oder Empathie. Das Gestalten einer glücklichen Beziehung ist die häufigste Frage die Beratern in der täglichen Praxis gestellt wird und somit eines der wichtigsten Beratungsthemen. Abbas Schirmohammadi, Heilpraktiker für Psychotherapie, Autor und Personality Coach, gibt in 10 einfachen Schritten […]
Mehr als eine Person lieben, kann das gut gehen? Das ist zumindest die Idee, die sich hinter Polyamorie versteckt – ein emotionaler Meilenstein. Wir lieben alle perfekte Paare, die traumhaft schön heiraten und sich ewige Treue schwören. Wir sind wütend, wenn wir mitbekommen, dass wir hintergangen wurden und unser Partner fremdgegangen ist. Wenn Liebe eine mathematische […]
Der Partner ist für viele Personen der wichtigste Mensch im Leben und so kannst du ihn positiv beeinflussen. Der Paarberater Christian Thiel hat sich diese Frage gestellt und sie folgender Maßen beantwortet. Vor ein paar Wochen sind Lena und Paul zusammen gezogen. Die beiden sind erst seit neun Monaten ein Paar und es haben sich […]
Seit das Internet Einzug in den Alltag vieler Menschen gehalten hat, ist nicht nur der Einkauf oder die Partnersuche bequemer geworden. Auch für Weltschmerz & Co gibt es online schnelle erste Hilfe. Wer sich auf die Suche begibt, verliert sich zunächst in einem unüberschaubaren und ständig wachsendem Angebot an Adressen. Die Anzahl der Einträge zum […]
Babys sehen auf den ersten Blick hilflos aus. Bis vor 20 Jahren konnten sich Pädagogen daher auch nicht vorstellen, dass Säuglinge bereits wichtige Informationen speichern und daraus lernen. Heute gilt als gesichert: Babys lernen bereits ab dem ersten Tag ihres jungen Lebens und sogar Einflüsse im Körper der Mutter wirken sich auf ihr späteres Verhalten […]
Im Interview schildert uns Vistano-Beraterin Susanne John ihre täglichen Gesprächserfahrungen aus den viel diskutierten Bereichen Partnerschaft und Sex. Die Malerin hat sich schon in den 1980er Jahren mit Tarot als Medium zur Öffnung des Unbewussten befasst. Dadurch hat sie ihren persönlichen Zugang zur Psychologie gefunden. Sie ist inzwischen als anerkannte psychologische Heilpraktikerin tätig. Ihre Schwerpunkte liegen dabei im […]
Schmetterlinge im Bauch, weiche Knie und so viel was man falsch machen kann. Das erste Date könnte man auch als ein sanftes Kennenlernen bezeichnen. So schön wie ein erstes Date sein kann, so unangenehm kann es auch werden, wenn man in Fettnäpfchen tritt. Manchmal passt einfach alles. Man versteht sich gut, spricht über viele Themen […]
Auch wenn die Mutter häufig als wichtigste Person im Zusammenhang mit der Prägung und Erziehung des Kindes genannt wird: Neue Studien weisen in eine andere Richtung. Grundsätzlich scheint die Vaterliebe für die Entwicklung und Prägung in gleicher Weise wichtig zu sein wie auch das weibliche Geschlecht. Wie äußert sich die Vaterliebe und was passiert, wenn sie […]
Stars und Sternchen, Prominente und berühmte Persönlichkeiten, die im Rampenlicht stehen, polarisieren oft mit ihrem Auftreten, sorgen für Gesprächsstoff und wecken in uns nicht selten ein Verlangen doch auch so zu sein – berühmt und beliebt. Vor allem in der Pubertät, aber auch später, kommt es vor, dass wir uns in einen Star verlieben oder zumindest […]
Mit dem warmen Wetter setzen bei einer Vielzahl von Menschen Jahr für Jahr auch die Frühlingsgefühle ein. Sobald man dann den Angebeteten oder die Angebetete erblickt, machen sich Schmetterlinge im Bauch breit und das Herz fängt unkontrolliert an zu klopfen. Dies sind dabei noch die angenehmsten Reaktionen, die der menschliche Organismus auf das Verliebtsein zeigt. […]