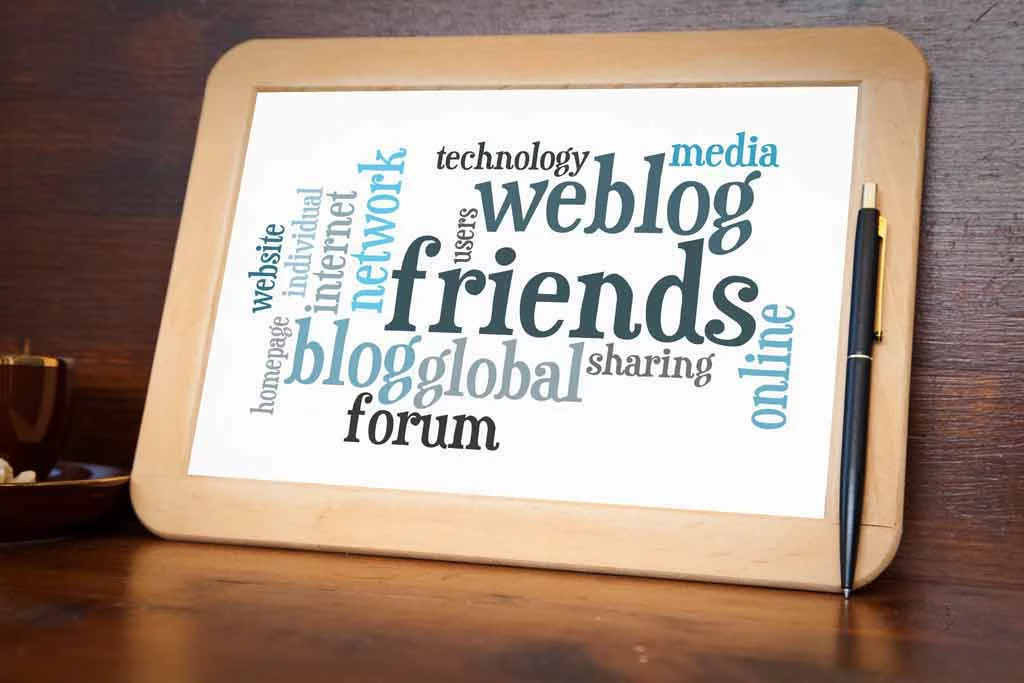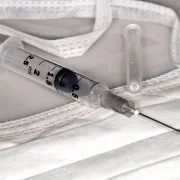Die Auswirkungen der Corona Krise auf den Menschen
Die Corona Krise bestimmt aktuell unser Leben. Stay at Home und Social Distancing sind Stichworte der Stunde. Doch was macht das Ganze mit uns? Für die ein- oder andere Person kann es ja ganz nett sein, wenn man keine Kinder betreuen muss und nicht im Homeoffice Stress versinkt. Aber da gibt es auch noch jene Menschen, für die das ganze Szenario dann doch viel erdrückender ist: Menschen mit Suchtproblemen, Menschen, die unter Einsamkeit und/ oder Depressionen leiden.
Was passiert mit jenen Menschen in der Krise und wie können sie sich helfen oder helfen lassen?
Gerade Menschen mit psychischen Problemen leiden unter der sozialen Distanz, die verschiedene Krankheitsbilder noch verstärkt. Um im Alltag damit umzugehen, haben viele Kliniken Krisentelefone eingerichtet, die psychosomatischen Abteilungen sind derzeit geschossen. Diese seidenen Fäden werden auch gut angenommen, aber die Kapazitäten reichen teilweise nicht aus. Natürlich ist der Zulauf bei den online Angeboten und in den Foren gerade auch viel größer, dennoch bleibt eine Lücke. Um so wichtiger ist das soziale Umfeld, auch wenn es sich nur digital kümmern kann.
Was macht die Corona Krise mit unserer Psyche?
Krisen rufen Ängste hervor, was zunächst nicht schlimm, sondern normal ist. Auch psychisch stabile Menschen fangen beispielsweise an sich vorzustellen, in die Situation zu kommen, auf einer Intensivstation beatmet zu werden. Es wird zu einer körperlichen Bedrohung, die zur Realität werden kann. Das ist so lange noch in Ordnung, wie sich die Angst nicht verselbstständigt und dysfunktional wird. Doch bei psychisch nicht so gut situierten Menschen, die diese Ängste nicht ertragen können, ist es nicht so einfach. So werden Ausweichstrategien wie z. B. der Griff zur Flasche, Cannabis, Online- oder Spielsucht, schneller genutzt, um sich abzulenken und Entspannung zu finden. Und das kann gefährlich werden.
Was macht die Krise mit diesen Menschen und wie können sie besser damit umgehen?
Ein geregelter Tagesablauf und ein gutes Maß an digitalen sozialen Kontakten sind von enormer Bedeutung. Kommen wir dem nicht nach, nimmt unsere Stimmung einen hohen Stellenwert ein und wir spüren sie auch viel schneller. Ist sie negativ, entsteht der Wunsch nach Betäubung und Ablenkung schneller. Wenn wir zulassen, dass unsere Emotionen den Tagesrhythmus vorgeben, gelangen wir schnell in eine Spirale aus Angst, Wut, grübeln, usw.
Auch ein guter Umgang mit sich selbst ist wichtig
Wir müssen auch berücksichtigen, welch großen Stress die soziale Isolation in unserer Psyche verursacht, deshalb ist es sehr wichtig, auch einen guten Umgang mit sich selbst zu haben. Man sollte achtsam mit sich umgehen, trotz Ängsten nach draußen an die frische Luft und in die Sonne gehen. Wenn wir uns an die Regeln halten, ist die Gefahr gering, dass uns etwas passiert.
Viele Menschen leiden auch unter der Tatsache, dass sie nicht wissen, wie lange die Situation noch so bleibt. Gerade für Menschen, denen das Planen wichtig ist, denen das Planen Sicherheit gibt, leiden unter der Unvorhersehbarkeit. Deshalb sind die Diskussionen über die schrittweise Auflockerung der aktuellen Beschränkungen wichtig, denn sie zeigen uns, dass die Krise endlich ist.
Was sollte man tun, um einen positiven Rhythmus zu behalten?
Bleibt aktiv! Zelebriert Eure sozialen Kontakte! Verabredet Euch zu mit Euren Freunden oder Kollegen zu einem digitalen Kaffee oder spielt digitales Stadt – Land – Fluss. Bleibt nicht im Bett liegen, auch wenn es noch so verlockend ist. Geht bei schönem Wetter unbedingt raus! Auch die Menschen im Homeoffice können in der Mittagspause die Sonne genießen und beschwingt wieder an die Arbeit gehen.
Wenn Ihr aber merkt, dass Euch das nicht gelingen will, bittet um Hilfe! Nutzt die Angebote am Telefon und im Internet, wie es beispielsweise Vistano Euch bietet. Die Zeit wird ein Ende haben und wir wünschen Euch allen, dass Ihr positiv und gesund bleibt!