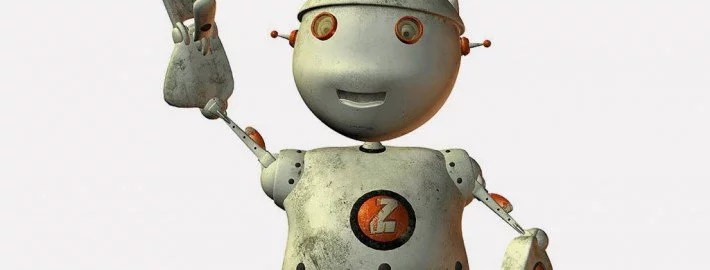Alle Menschen sind verschieden. Sie sind sich allerdings in vielen Aspekten auch sehr einig. Das gilt nicht nur für unsere Auffassung von menschlichen Grundrechten. Es gilt insbesondere für die uns als Erbe mitgegebenen gemeinsamen menschlichen physischen und psychischen Strukturen und für bestimmte Verhaltensweisen. In einem Interview mit der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Psychologie heute“ gibt der […]
Schlagwortarchiv für: Emotionen
Du bist hier: Home » Emotionen
Beiträge
Eine neue Untersuchung hat ergeben, dass es sich finanziell und beruflich auszahlt, korrekt auf die Gefühle der Mitmenschen einzugehen. Gerhard Blickle ist Arbeitspsychologe und untersuchte verschiedene Mentalitäten sowie ihre Zusammenhänge. Dabei interessierte er sich besonders für den Unterschied zwischen dem Umgang mit Gefühlen bei Berufstätigen und dessen Auswirkungen auf Faktoren wie die Einstellung der Kollegen […]
In allen Sprachen gibt es Worte, die Emotionen wiedergeben, aber ist die Bedeutung dieser Begriffe auch immer gleich? Jüngst wurde eine Studie darüber durchgeführt, ob bzw. wie unterschiedlich die Bedeutung von Emotionswörtern in verschiedenen Sprachen ist. Ob ein Wort Gutes oder Schlechtes ausdrückt, scheint überall auf der Welt gleich empfunden zu werden. Aber schaut man […]
Wissenschaftler führten jetzt eine Untersuchung über die menschliche Reaktion bei Entscheidungen um Leben und Tod durch. Dafür wurden gesunde und hirngeschädigte Probanden ausgesucht. Das Szenario: Außer Kontrolle rast eine Straßenbahn auf eine Gruppe von Menschen zu. Auf dem Gleis nebenan befindet sich hingegen nur eine Person. Wie entscheiden sich die Teilnehmer, wenn die Möglichkeit bestünde, […]
Absicht emotionaler Erpressung? Immer wieder bestimmen Drohungen, Vorwürfe oder Schweigen die Partnerschaft. Das Resultat aus diesem Verhalten sind Schuldgefühle des Partners und ein zunehmender Druck. In vielen Fällen kann damit ein Anliegen durchgesetzt werden, das auf normalem Weg nicht erreicht werden kann. Emotionale Erpressung nennt sich dieses Phänomen, das weit verbreitet ist und in vielen […]
An der Technischen Universität Braunschweig untersuchten Psychologen kürzlich in einer Langzeitstudie unterschiedliche Parameter hinsichtlich ihrer Vorhersagekraft für Scheidung und Trennung. Lässt sich eine Trennung vorhersagen? Etwa 35 Prozent der Ehen hierzulande scheitern. Meist stellt dies eine große Belastung für die Betroffenen, ihre Kinder, die Angehörigen und das soziale Umfeld dar. In einer Langzeitstudie versuchten nun […]
Empathie, die Fähigkeit Gedanken, Emotionen, Gefühle und Persönlichkeitsmerkmale anderer Personen zu erkennen und zu verstehen, hat einen guten Ruf. Viele Menschen glauben, dass diese Fähigkeit Voraussetzung ist, um Fairness und Hilfsbereitschaft zu erfüllen. Wer in der Lage ist mit einer anderen Person mitzufühlen, bringt auch die Motivation auf, um in Notsituationen beizustehen und zu helfen. […]
Der Mensch kann sich erfreuen und auf der anderen Seite traurig sein. Auch kann er ängstlich oder wütend auf etwas oder jemanden sein. Emotionen, die wir alle kennen und nicht selten selbst erleben. Bisher dachten Experten allerdings, dass der Mensch ausschließlich die nachfolgenden sechs Emotionen empfinden kann: Glück, Trauer, Wut, Ekel, Angst und Überraschung. Ein […]
Nicht jeder Autist ist absolut gefühlskalt! Laut Forschern aus Wien und Triest handelt es sich dabei vielmehr um ein Syndrom namens Alexithymie. Oft hört man, dass Autisten gefühllos und kalt sind. Dieses Image wurde durch den Amoklauf 2015 in Oregon verstärkt als der 26 jährige Täter als Autist diagnostiziert wurde. Es wurde nach dem Amoklauf […]
Wenn man Barbara Fredrickson glauben darf, machen Geschenke nicht nur glücklich, sondern sorgen auch dafür, dass man mehr Ideen hat, hilfsbereiter gegenüber anderen Menschen wird, mehr Mitgefühl zeigt und aufgeschlossener ist. Es scheint also so, dass Geschenke dafür sorgen, dass man für ein Weilchen sein besseres Ich entdeckt. Die Psychologin aus den USA beschäftigt sich […]
Was ist Liebe? Über diese Frage haben sich schon Heerscharen von Forschern, Wissenschaftlern und psychologischen Therapeuten den Kopf zerbrochen, mit mehr oder weniger nachvollziehbarem Ergebnis. Bei der Frage, ob Tiere Liebe empfinden können, wird die Antwort nicht gerade einfacher, denn man kann die vierbeinigen, gefiederten oder sonstigen tierischen Probanden schliesslich nicht um ein Statement bitten. […]
Jedem von uns ist es schon einmal passiert: Man befindet sich am Arbeitsplatz und plötzlich passiert etwas, was eine heftige Emotion in Gang setzt. Das kann der Ausfall des Druckers sein, eine ungerechte Beurteilung durch den Chef oder etwas noch viel banaleres. Doch wie sollte man sich am Besten verhalten in solch einer Situation? Sollte […]
Nicht selten greift man zu Schmerzmitteln. Wenn der Kopf schmerzt, die Gelenke beansprucht sind oder Gliederschmerzen vorliegen, der Griff in die Hausapotheke ist schnell gemacht. Präparate wie Ibuprofen und Paracetamol gehören zu den gängigsten Mittelchen, die in jedem Haushalt vorhanden sind. Eine Studie zeigt nun, dass Paracetamol nicht nur Schmerzen lindert, sondern auch positive wie […]
Eine Studie zeigt, dass Menschen auch mit Robotern mitleiden. Die Technisierung unserer Gesellschaft schreitet immer weiter voran. Fast jeder Jugendliche hat ein Facebook Profil und nahezu jede Frau und jeder Mann ein Smartphone. Wir können uns unser Leben ohne Flachbildfernseher und Internetflatrate kaum noch vorstellen. Doch wie ist es um unsere Emotionen bestellt, wenn es […]
In Indien benutzt man Räucherstäbchen und Kräuterduft, um negative Emotionen zu vertreiben, die aus der Vergangenheit hängen geblieben sind. Doch Indien ist mit solchen Ängsten nicht allein auf der Welt. Für den Psychologen Krishna Savani steht fest, dass Amerikaner nicht gerne in einem Büros sitzen und arbeiten wollen, das zuvor von einem schlecht gelaunten Menschen […]
In den Hollywood-Blockbustern kann man es sehr gut beobachten: Wenn sich die Protagonistin verliebt, bekommt sie diese rauchige Femme-fatale-Stimme, legt oft den Kopf schräg und versucht mit dem kindlichen Lolita-Attributen zu punkten. Vielleicht kennen Sie das ja auch von sich selbst: Wenn Sie mit jemandem telefonieren, der oder die Ihnen am Herzen liegt, wird Ihre […]
Ist es nicht eigentlich ein Widerspruch, dass wir weinen, wenn wir uns freuen? Denn eigentlich stehen Tränen doch für Trauer, und Freude ist doch das komplette Gegenteil. Die Psychologin Oriana Aragon von der Yale University in New Haven (Connecticut) hat sich mit diesen zweigestaltigen Gefühlen beschäftigt. Sie wollte herausfinden, wie diese entstehen. Für widersprüchliche Signale […]
Glück wollen wir alle haben – aber was genau ist Glück eigentlich und wie kann man es sich verschaffen? Gäbe es darauf eine Antwort, wären alle Menschen auf dieser Welt glücklich. Eine Anleitung zum Glücklichsein, die für jedermann gilt, gibt es leider nicht. Glück ist nämlich eine ganz persönliche Angelegenheit und spielt sich ausschließlich in […]
Kochen hat für viele Menschen sehr viel mit Gefühl und oft sogar mit Leidenschaft zu tun. Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, führte eine Gruppe Psychologiestudenten und eine Gruppe von angehenden Köchen ein interessantes Experiment durch. Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren beschäftigten sie sich mit der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Essen, […]
Dein Nachbar und Du, ihr könnt euch einfach nicht riechen? Allein schon bei dem Geruch von bestimmten Lebensmitteln hast Du das Gefühl, dir dreht sich der Magen um? Gerüche beeinflussen in ganz entscheidendem Maße unsere Emotionen und unser Wohlbefinden. Gerüche und Erinnerungen Max möchte bei dem Geruch von Druckerschwärze am liebsten sofort das Weite suchen. […]