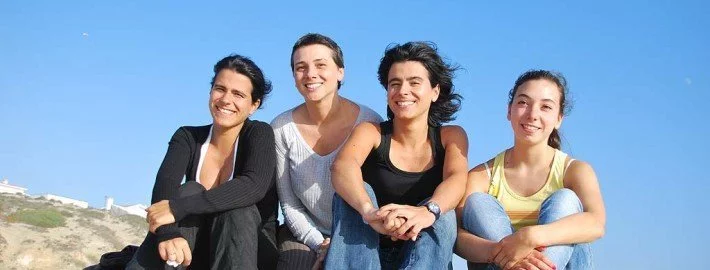Dass viele Frauen nach der Geburt ihres Kindes an Depressionen leiden, ist hinlänglich bekannt. Der folgende Artikel beschäftigt sich nun mit den Männern und ihren depressiven Leiden im Vorhinein oder nach der Geburt eines Kindes. Etwa 10 bis 30 Prozent der Frauen leiden während der Schwangerschaft an schwerwiegenden depressiven Verstimmungen. Auch nach der Schwangerschaft ereilen […]
Archiv für die Kategorie: Eltern & Erziehung
Du bist hier: Home » Eltern & Erziehung » Seite 3
Psychologie – Eltern & Erziehung
Dass Stillen mit Muttermilch für Babys nur Vorteile hat und kaum ein Produkt die Wirkkraft von natürlicher Muttermilch nachahmen kann, ist längst bewiesen. Eine Studie hat sich nun mal die „andere Seite“ angeschaut und zwar die Emotionen, welche bei der stillenden Mutter ausgelöst werden. Dass die Bindung zwischen Kind und Mutter im Stillakt gestärkt wird, […]
Man sagt gemeinhin, dass Zwillinge alles miteinander teilen. Sie wachsen nicht nur gemeinsam im Bauch der Mutter heran, sondern teilen sich auch eine Familie, wachsen gemeinhin zusammen auf und entstammen dem gleichen Erbgut. Wissenschaftler haben nun Zwillingspaare genauer betrachtet, von denen ein Kind unter dem Down-Syndrom leidet. Was bedeutet diese Krankheit für die Entwicklung beider […]
Frühgeburten überleben immer häufiger. Dennoch sind schwere Behinderungen umso wahrscheinlicher, je früher ein Kind geboren wird. Die Quote einer Zerebralparese liegt beispielsweise bei termingerecht geborenen Kindern bei 1-2 Prozent, während es bei Geburten vor der 32. Woche 9 Prozent und bei Geburten in der 26. Woche sogar 18 Prozent sind. Neurowissenschaftler haben jetzt in einer […]
Seit einigen Wochen ist eine Diskussion über das Kinderkriegen im höheren Alter entfacht. Nachdem eine 65 Jährige Frau namens Annegret Raunigk in Folge einer Eizellen- und Samenspende erneut schwanger geworden ist und das obwohl sie schon 13 Kinder zur Welt gebracht hat, wird die Frage laut, ab welchem Alter es ethisch nicht mehr vertretbar ist, […]
Totaler Mutismus bezeichnet im fachmedizinischen Jargon das situationsübergreifende Schweigen, das einen Menschen befallen kann. Viel häufiger ist allerdings der selektive Mutismus, der bei Betroffenen dazu führt, dass sie nur in bestimmten Situationen schweigen und verstummen. Im ICD-10 wird der selektive Mutismus als emotional bedingte Stummheit in bestimmten Situationen beschrieben. Oftmals führt das Verstummen oder auch […]
Viele Jahre lang wurden nahezu jedem verhaltensauffälligen Kind ohne zu zögern ADHS-Medikamente verschrieben. Doch dieser Trend scheint nach und nach zurückzugehen. Schon das zweite Jahr in Folge wurden in Deutschland nun weniger Medikamente dieser Art verschrieben. Dazu zählt insbesondere der Gebrauch von Methylphenidat, das in der Öffentlichkeit eher als Ritalin bezeichnet wird. Dessen Einnahme ging […]
ADHS beeinflusst nicht nur die Aufmerksamkeit der betroffenen Menschen, sondern auch das Selbstbild, das sie im Laufe ihres Lebens von sich entwickeln. Durch die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung erleben die Kinder und Jugendlichen oftmals negative Ereignisse und zahllose Rückschläge. Zudem können die Mitschüler das aufgedrehte und unruhige Verhalten der Betroffenen in den meisten Fällen nicht verstehen und lehnen sie […]
Einschätzung der Krankheit Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung äußert sich vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen und Empfindungen, es spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle. Die Betroffenen sind sehr instabil und neigen dazu die Bewältigung des eigenen Alltags als zu anstrengend zu empfinden. Auch dissoziative und psychotische Symptome sind möglich. Besteht der Wunsch nach einem Kind, kann im […]
Eine Familie ist in vielen Situationen einer Herausforderung ausgesetzt. Denn wenn Konflikte auftreten, dann ist dies ein sehr zermürbender Prozess. Immerhin können diese sehr tief sitzen und sind aufgrund der vielen Beteiligten oftmals auch vielschichtiger als Konflikte innerhalb von Paarbeziehungen. Es gibt wahrlich viele Herausforderungen, die eine Familie durchleben muss. Doch hin und wieder kann […]
Die Zahl der Ehescheidungen nimmt stetig zu und natürlich sollten hierbei die vielen Kinder nicht vergessen werden, die von der Trennung der Eltern ebenso betroffen sind, wie die Partner selbst. Hierbei sollten Entwicklungsunterschiede von Scheidungskindern und solchen, die in Kernfamilien aufgewachsen sind, betrachtet werden. In einer Kernfamilie leben die Kinder mit den leiblichen Eltern zusammen. […]
Der österreichische Arzt Hans Asperger war es, der in den 1940er Jahren die nach ihm benannte Krankheit erstmals beschrieben hat. Seiner Erkenntnis nach handelt es sich dabei um eine Entwicklungsstörung, die autistische Züge trägt. Anders als beim Autismus sind die Symptome beim Asperger Syndrom jedoch schwächer ausgeprägt. Jedoch besteht beim Asperger Syndrom leicht die Gefahr, sie mit […]
„Cool Sein“ ist alles, das zumindest scheinen immer noch viele – und nicht nur Jugendliche – zu glauben. Und wer cool ist, der hat immer einen lockeren (eben „coolen“) Spruch auf den Lippen, nimmt alles „easy“ (also leicht) und bestimmt nichts ernst … außer sich selbst und seinem eigenen Image natürlich, wozu durchaus die gesamte […]
Viele Menschen sehnen sich nach einer Familie. Nicht Wenige unter ihnen geraten dadurch mit sich selbst in Konflikt, da sie sich insgeheim nicht zutrauen, eine eigene Familie zu gründen. Denn einfach „eine Familie sein“ erscheint nicht ausreichend. Jede und jeder wünscht sich eine glückliche Familie. Und viele glauben, sie könnten dieses Ziel nicht erreichen, da sie […]
Die „Times of India“ berichtete in den letzten Tagen von einer australischen Studie, der zufolge neun von zehn Menschen unter 30 süchtig nach ihrem Handy oder Smartphone sind. Das Handy ist das Erste, das nach dem Aufstehen zur Hand genommen wird und das Letzte, das vor dem Löschen des Lichts nochmal gecheckt wird. In krassen […]
Teilen ist eine soziale Kompetenz, die – manchmal mühsam – erlernt werden muss. Es ist zumindest noch kein genetischer Zusammenhang gefunden worden, obwohl man das denken könnte, wenn man zwei Kinder in einem Meer von bunten Schaufeln um die eine blaue kämpfen sieht. Wann beginnt das Kind einen eigenen Anspruch auf bestimmte Gegenstände zu erheben? […]
In einer gemeinsamen Studie haben das Norwegian Institute of Public Health (NIPH) und die Universität Oslo interessante Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen der psychischen Verfassung von Müttern und den Ernährungsgewohnheiten ihrer Kinder festgestellt. Einbezogen wurden rund 28.000 Frauen mit Kindern im Alter von 18 Monaten. Die Forscher gingen dabei von dem Gedanken aus, dass die Folgen von […]
Kinder, die in ihrer eigentlichen Familie zeitweise oder dauerhaft nicht versorgt werden können, finden innerhalb der Familienform Pflegefamilie eine Alternative zur Unterbringung im Heim. Anders als in einem Heim bietet eine Pflegefamilie ihnen eine beständige Bezugsperson. Gerade Kinder, die unter Trennungen oder Versorgungsmangel gelitten haben, können diese Erfahrungen in einer liebevollen Pflegefamilie verarbeiten. So bietet die Pflegefamilie […]
Enuresis (nächtliches Bettnässen, Enuresis nocturna) ist bei Kindern und Jugendlichen häufig zu beobachten. Untersuchungen zu folge nässt bei den Siebenjährigen etwa jedes 10. Kind nachts ein. Hier nutzen Strafen oder gar der Entzug von Flüssigkeit überhaupt nichts. Wichtiger wäre es, die Ursachen fürs Bettnässen zu finden und mit einer geeigneten Therapie zu beginnen. Wann spricht man von einer […]
Wer wünscht sich nicht ein Kind, das exakt den eigenen Wünschen entspricht? Ein Designer-Baby sozusagen? Wäre das nicht toll oder doch ziemlich erschreckend? Die Gentest-Firma 23andMe könnte dies bald möglich machen, zumindest haben sie ein Patent angemeldet und erhalten. Wer ist 23andme und was bieten sie an? Der Name der Firma bezieht sich auf die 23 Chromosomenpaare […]