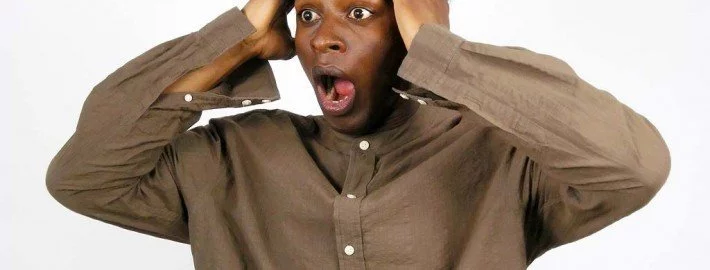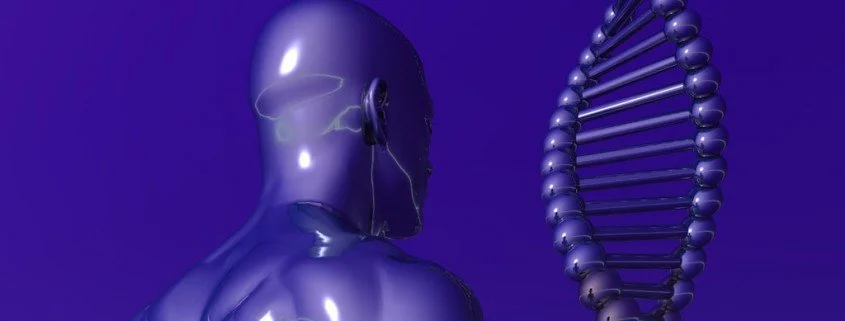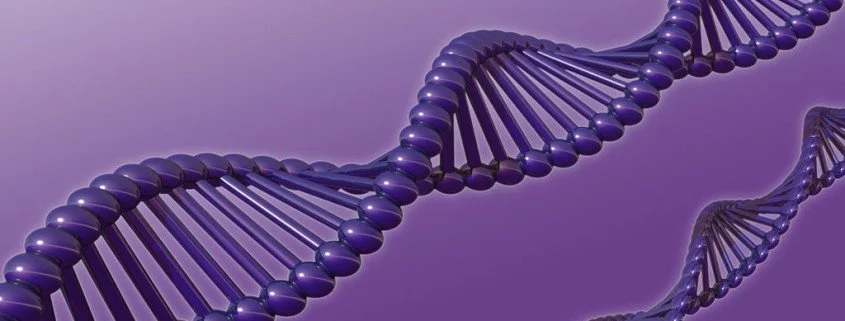Sogenannte „Panikstörungen“ belasten rund ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Betroffene Menschen sind ohne erkennbare äußere Einwirkungen und Warnzeichen von plötzlichen heftigen Angstzuständen betroffen, die mit starken körperlichen Symptomen (Schweißausbrüche, Herzrasen und in dessen Folge Hyperventilation) einhergehen. Bislang hatte die Forschung auf diesem Gebiet bereits eine enge Verbindung zur Angst vor großen Plätzen (Agoraphobie) festgestellt. […]
Schlagwortarchiv für: Genetik
Du bist hier: Home » Genetik
Beiträge
In manchen Gegenden der Welt geben Menschen bei Umfragen häufig an, glücklich zu sein. Andere Regionen hingegen scheinen von schlechter Laune geprägt. Forscher haben nun herausgefunden, dass dieses Phänomen an einem sogenannten Glücksgen liegen könnte. Der bulgarische Forscher Michael Minkov kommt selbst aus einem Land, dass eher schlecht abschneidet in Sachen Glück. Der Wissenschaftler sorgte […]
Bei der Krankheit Manie handelt es sich um eine sogenannte affektive Störung. Die Forscher der Universität Bonn kamen nun zu der Erkenntnis, dass die Manie von einem bestimmten Gen verursacht wird. Menschen, die an einer manischen Depression erkrankt sind, fallen durch ihre extremen Stimmungslagen auf. Diese sind buchstäblich „Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt“. Den […]
Eine interessante Entdeckung vermeldete jetzt das Wellcome Trust Centre for Human Genetics in den USA. Wissenschaftler konnten dort feststellen, dass Menschen, die durch dunkle Zeiten gehen oder Personen mit der Neigung zu Depressionen, einen schnelleren Alterungsprozess ihrer Gene zeigen als solche Menschen, die glücklich und gesund sind. Diese Ergebnisse waren selbst für die Forscher so […]
Jeder Mensch lebt nach seiner Fasson. Ob jemand lieber als Single lebt oder lieber in einer Beziehung, hängt unter anderem von einem Gen ab, das Wissenschaftler nun lokalisiert haben. Bisher war jedem klar, ob jemand allein lebt oder gleich von einer Beziehung in die nächste schlittert, hängt von vielen Faktoren ab. So ist z.B. das […]