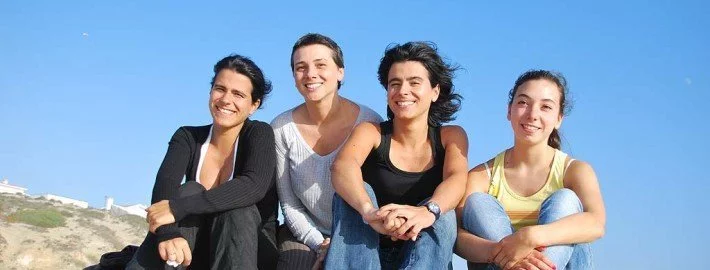Viele Menschen sehnen sich nach einer Familie. Nicht Wenige unter ihnen geraten dadurch mit sich selbst in Konflikt, da sie sich insgeheim nicht zutrauen, eine eigene Familie zu gründen. Denn einfach „eine Familie sein“ erscheint nicht ausreichend. Jede und jeder wünscht sich eine glückliche Familie. Und viele glauben, sie könnten dieses Ziel nicht erreichen, da sie […]
Schlagwortarchiv für: Familie
Du bist hier: Home » Familie
Beiträge
Weihnachten ist nicht nur das letzte Fest vor dem Jahreswechsel. Es hat weiterhin eine ganz besondere Bedeutung. Viele Menschen bemühen sich daher ein perfektes Fest zu gestalten. Viele Vorstellungen sind gerade zu diesem Anlass vorhanden und nicht alle davon können von den Beteiligten künstlich herbeigeführt werden. Zudem wird dem Menschen durch die Medien ein Bild […]
Kinder, die in ihrer eigentlichen Familie zeitweise oder dauerhaft nicht versorgt werden können, finden innerhalb der Familienform Pflegefamilie eine Alternative zur Unterbringung im Heim. Anders als in einem Heim bietet eine Pflegefamilie ihnen eine beständige Bezugsperson. Gerade Kinder, die unter Trennungen oder Versorgungsmangel gelitten haben, können diese Erfahrungen in einer liebevollen Pflegefamilie verarbeiten. So bietet die Pflegefamilie […]
Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt neue Freiheiten mit sich. Doch können flexible Arbeitszeiten nicht nur eine Chance für den Arbeitnehmer darstellen, sondern auch Risiken bergen. Immer mehr Menschen können sich nachmittags frei nehmen, Zeit mit den Kindern und der Familie verbringen, in den Zoo gehen. Die Arbeit erledigen sie dann abends von zu Hause aus. […]
Einschätzung der Krankheit Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung äußert sich vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen und Empfindungen, es spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle. Die Betroffenen sind sehr instabil und neigen dazu die Bewältigung des eigenen Alltags als zu anstrengend zu empfinden. Auch dissoziative und psychotische Symptome sind möglich. Besteht der Wunsch nach einem Kind, kann im […]
Die Zeiten ändern sich. Und mit ihnen auch die Menschen, wie neue Studien belegen. Was schon fast Tradition war, wird nun immer mehr durch ein neues Bild von Mann und Frau geprägt. Dies gilt nicht mehr nur im privaten Bereich – auch der Beruf und die Karriere wird von den Geschlechtern unterschiedlich behandelt. Studien belegen […]
Eine Familie ist in vielen Situationen einer Herausforderung ausgesetzt. Denn wenn Konflikte auftreten, dann ist dies ein sehr zermürbender Prozess. Immerhin können diese sehr tief sitzen und sind aufgrund der vielen Beteiligten oftmals auch vielschichtiger als Konflikte innerhalb von Paarbeziehungen. Es gibt wahrlich viele Herausforderungen, die eine Familie durchleben muss. Doch hin und wieder kann […]
Wie würden Sie auf die Frage antworten, ob Ihre Schwiegermutter a)„liebevoll”, b)„respektvoll”, c)„bevormundend” oder gar d)„hinterhältig” sei? 34 verheiratete Frauen beantworteten der Psychologin Andrea Kettenbach diese Frage, denn sie nahmen an deren Studie teil. Nach Auswertung dieser und weiterer Fragen stellte sich heraus, dass sich das Vorurteil über böse Schwiegermütter in der Realität nicht bewahrheitet. […]
Der weltweite Trend zum Einzelkind ist auch in Deutschland unverkennbar: So war hierzulande im Jahr 2013 die EU-weit niedrigste Geburtenrate zu verzeichnen: Pro 1.000 Einwohner zählte man nicht mehr als 8,4 Geburten. Da ein signifikanter Anstieg in den kommenden Jahren unwahrscheinlich ist, steht die Frage im Raum, welche Auswirkungen das Aufwachsen als Einzelkind auf die […]
Glück wollen wir alle haben – aber was genau ist Glück eigentlich und wie kann man es sich verschaffen? Gäbe es darauf eine Antwort, wären alle Menschen auf dieser Welt glücklich. Eine Anleitung zum Glücklichsein, die für jedermann gilt, gibt es leider nicht. Glück ist nämlich eine ganz persönliche Angelegenheit und spielt sich ausschließlich in […]
Feiertage teilen das Jahr ein und verkürzen die arbeitssame Zeit bis zum Jahreswechsel, wie eine Studie bereits vor Jahren belegte. Ohne Feiertage wäre das Jahr subjektiv endlos. Die besonderen Tage sind dabei häufig mit Ritualen versehen, die eine wichtige Bedeutung haben. Auch die Weihnachtsrituale folgen dieser Regel. Eine Zeit der Sicherheit und Ruhe Weihnachten ist […]