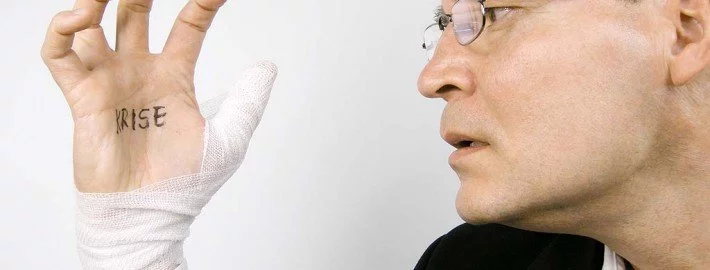Erziehung durch Medien ist immer wieder ein Streitthema. Während die Produzenten von pädagogisch angehauchten Fernsehsendungen und Videos die Meinung vertreten, Kinder könnten durch Fernsehsendungen etwas lernen, haben sich Experten mit einer kritischen Erklärung zu dem Thema TV-Programme mit Lerneffekt zu Wort gemeldet. TV Konsum hemmt die Entwicklung Die Amerikanische Akademie für Pädiatrie ist nicht die einzige […]
Archiv für die Kategorie: Eltern & Erziehung
Du bist hier: Home » Eltern & Erziehung » Seite 6
Psychologie – Eltern & Erziehung
Sonderfall Scheidungskind Oftmals ist es nicht möglich, dass Scheidungskinder beide Elternteile täglich sehen. Der Kontakt minimiert sich dadurch. Hinzu kommt, dass viele Eltern eine ablehnende Haltung gegenüber dem ehemaligen Lebensgefährten einnehmen. Rachegefühle werden ausgelebt und in Gegenwart des Kindes offen artikuliert. Oftmals ist das Wohl des Kindes nur vordergründig vorhanden und die Heranwachsenen werden zum Werkzeug […]
Mutter zu werden, ist für jede Frau eine der aufregendsten Phasen im ganzen Leben. Der Grund dafür, dass dieser Lebensabschnitt -Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach – oft als so außerordentlich aufwühlend empfunden wird, liegt in der schwungvollen Achterbahn, welche die Hormone einer frisch gebackenen Mutter durchlaufen. Für etwa 10 Prozent der Frauen, die ihr […]
Wie würden Sie auf die Frage antworten, ob Ihre Schwiegermutter a)„liebevoll”, b)„respektvoll”, c)„bevormundend” oder gar d)„hinterhältig” sei? 34 verheiratete Frauen beantworteten der Psychologin Andrea Kettenbach diese Frage, denn sie nahmen an deren Studie teil. Nach Auswertung dieser und weiterer Fragen stellte sich heraus, dass sich das Vorurteil über böse Schwiegermütter in der Realität nicht bewahrheitet. […]
Manche Kinder haben zwei Mütter oder zwei Väter. Kinder, die in einer sogenannten Regenbogenfamilie aufwachsen und gleichgeschlechtliche Eltern haben, fühlen sich einer Studie der Universität Bamberg zufolge weder benachteiligt noch unglücklich – es ist vielmehr das Gegenteil der Fall. Schwierigkeiten treten nur dann auf, wenn das Umfeld intolerant reagiert. Lesbische Frauen stellen in der Gruppe […]
Eltern können ihr Kind am besten fördern, indem sie sie in Ruhe (spielen) lassen. Dies soll nicht als Aufforderung zur Vernachlässigung verstanden werden, sondern als Hinweis dafür, dass Kreativität ihren Freiraum braucht. Es ist nur allzu verständlich, dass sich Eltern darüber Gedanken machen, welches Spielzeug und welche Beschäftigung für ihr Kind sinnvoll ist. Dazu kommt […]
Ca. 150.000 Menschen sind von Autismus betroffen, ca. 300.000 Menschen leiden unter einer Autismus-Spektrum-Störung, einer abgeschwächten Abwandlung von Autismus. In beiden Fällen handelt sich um eine tief- und weitgreifende Störung der Entwicklung, die sich ca. im dritten Lebensjahr erstmalig zeigt. Für Eltern und Familien der betroffenen Kinder ist die Krankheit im doppelten Sinn eine Herausforderung. […]
Ein guter Lehrer hat nicht nur die Fähigkeit zur Pädagogik im Blut, sondern er hat vermutlich pädagogische Psychologie als Nebenfach studiert. Es ist nämlich kein Zufall, wenn Lehrer und Lehrerinnen einen guten Zugang zu ihren Schülern finden, sondern es steckt eine erlernbare Wissenschaft dahinter. Pädagogische Psychologie gehört als Teilgebiet zur Wissenschaft der Psychologie. Sie befasst […]
Können Sie auch nicht mehr durchschlafen, seit Sie Eltern geworden sind? Hier kommt eine gute Nachricht für Sie, die Sie motivieren und aufbauen soll: Ihr Kind kann schlafen lernen! Nächtliche Flurwanderungen sind für junge Eltern an der Tages- bzw. Nachtordnung. Es dauert einfach seine Zeit, bis sich das Baby von alleine dem Schlafrhythmus der Eltern […]
Spielfilme und Liebesromane haben ihr Happy End an einer Stelle, wo der Ärger eigentlich erst so richtig losgehen kann. Die Hochzeit ist zwar für jedes Liebespaar ein Ziel, das unter Umständen nur über Holperwege zu erreichen ist, aber danach geht es nicht unbedingt immer ebenerdig weiter. Wenn die Ehe kriselt, fragen sich die meisten Paare, […]
Es ist wichtig, dass Eltern die Begabungen ihres Kindes kennen. Tests und wissenschaftliche Untersuchungen können den Grad der Begabung zeigen. Welche Fähigkeiten und Neigungen sonst noch vorliegen, können Sie als Eltern durch eine genaue Beobachtung Ihres Kindes herausfinden. Dazu ist allerdings mehr als nur Zuschauen nötig. Um mit verschiedenen Bereichen im kognitiven, sensitiven oder körperlichen […]
„Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben!” Wer hat diesen Satz nicht schon einmal gehört? Er ist so abgedroschen und trotzdem stimmt er inhaltlich. Allerdings haben Eltern und Kinder vom Schulalltag oft genug einen anderen Eindruck und das liegt zum Einen am allgemeinen Leistungsdruck und zum Anderen an mangelnder Motivation. Es ist […]
Dass Kinder offensichtlich an einer Konzentrationsschwäche leiden, fällt meistens im Kindergarten oder während der Schulzeit auf. Die betroffenen Kinder stören den Unterricht, spielen den Klassenclown und werden mitunter sogar aggressiv. Dass die Ursache für diese Verhaltensauffälligkeiten in einer Störung der Konzentrationsfähigkeit liegt, wird leider nicht immer rechtzeitig erkannt, denn im Vordergrund stehen zunächst die unangenehmen […]