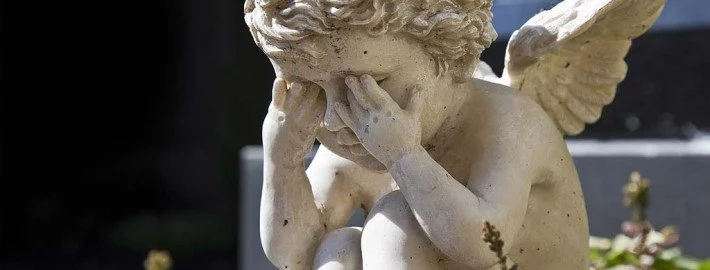Ältere Menschen brauchen Jüngere, soviel steht fest, doch warum ist das so? Was sind die Gründe, ist es nur die Unterstützung bei alltäglichen Dingen oder gibt es noch weitere Zusammenhänge. Eine Studie aus Stockholm belegt, dass Menschen, die sich in den 60ern befinden eine um 2 Jahre höhere Lebenserwartung haben, wenn sie ein Kind haben, […]
Archiv für die Kategorie: Angehörige
Du bist hier: Home » Angehörige
Psychologie – Angehörige
Sein Leben für andere geben. Was steckt hinter einer solchen Bereitschaft? Ein wichtiger Faktor ist das gemeinsame Erleben schrecklicher Erfahrungen, was die Beteiligten, auch nicht verwandte Menschen, zusammenschweißen lässt. Menschen sind soziale Wesen. Einer Gruppe anzugehören hat sich schnell als überlebenswichtig erwiesen. Auch das kooperative Verhalten innerhalb der Verwandtschaft und der Gruppe zeigte sich im Laufe […]
Anhand von Tierversuchen ist es Forschern der Universität und der ETH Zürich gelungen zu zeigen, dass Traumata vererbt werden können. Das Gute ist jedoch, dass laut den Forschern Traumata reversibel sind. Können Traumata wirklich vererbt werden? Wer in seiner Kindheit Schweres erlebt hat, hat höhere Chancen auch einmal unter einer psychischen Krankheit zu leiden oder […]
Das Alter bringt oft seine Herausforderungen mit sich. Doch Verheiratete leben meist länger und gesünder. Denn nicht nur die eigene Zufriedenheit, sondern auch die des Partners bzw. der Partnerin, tragen zu einem gesunden Alter bei. Zufriedenheit und Gesundheit sind von großer Bedeutung im Alter Es ist keine überraschend neue Erkenntnis, dass glückliche Menschen in der […]
Die meisten Menschen wollen am liebsten zu Hause sterben. Eine neue Umfrage zeigt, dass 60% der Befragten lieber Zuhause sterben würden als in einem Krankenhaus oder in einem Altersheim. Trotzdem stirbt nur jeder fünfte in den eigenen vier Wänden. Die meisten sterben im Krankenhaus oder im Pflegeheim – auch wenn das vermutlich kaum einer von ihnen […]
Heutzutage kommt es viel häufiger vor als wir denken, dass beim Tod eines geliebten Freundes die Hinterbliebenen in sozialen Netzwerken wie etwa auf Facebook den Austausch miteinander intensivieren. Freunde und Bekannte des Verstorbenen versuchen auf diese Art und Weise den Verlust langfristig auszugleichen. Bei einem Trauerfall rücken Freunde meist deutlich enger zusammen. Es braucht Zeit den […]
Weltweit durchgeführte Studien belegen, dass Altersdiskriminierung leider noch immer ein nicht zu unterschätzendes Problem darstellt. Dabei haben Experten nun herausgefunden, dass wir etwa 7 ½ Jahre länger leben können, wenn wir das ganze Thema des Älterwerdens entspannter betrachten. Altersdepression und Einsamkeit Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) veröffentliche kürzlich einen Bericht, in dem davor gewarnt wird, dass Altersdiskriminierung […]
Zahlreiche Angehörige können die Kosten für ein Pflegeheim nicht aufbringen oder möchten ihre Eltern oder Großeltern nicht ohne weiteres in ein Heim schicken. Aus diesem Grund pflegen viele ihre Angehörigen zu Hause. Doch ist ihnen oft nicht klar, wie hoch die körperliche und psychische Belastung bei häuslicher Pflege sein kann. Eine Studie im Auftrag der […]
Depressionen setzen einem schwer zu und wer darunter leidet, schafft es nicht, sich um seine Mitmenschen zu kümmern. Oft trifft es Kinder sehr hart, weil ihre Eltern psychisch krank sind und sie sich auf einmal zuhause um alles kümmern müssen. Leider fällt das viel zu selten auf und das ist ein großes Problem. Hier ein […]
Die Emotion Trauer ist eine gesellschaftlich nicht akzeptierte Empfindung. Die Trauer nach einem Todesfall wird zwar von der Mehrheit der Menschen nachvollzogen, allerdings ist die wichtige Bedeutung der Trauer längst in Vergessenheit geraten. Wer sich lange Zeit negativ und in seiner Trauer versunken zeigt, gilt als charakterschwach. Besonders in Zeiten der vorherrschenden Leistungsgesellschaft ist es […]
Das Zugunglück in Bad Aibling wirft wieder ein neues Licht auf den Prozess des Trauerns. Wie können Betroffene dieses Unglück verarbeiten und mit dem erlittenen Verlust umgehen? Wie lange dauert eigentlich die Zeit des Trauerns? Psychologen der Universität Würzburg haben sich dieser Frage in einer aktuellen Studie genähert und damit einige gängige Vorstellung des Trauerprozesses […]
Souvenirs können beim Trauern helfen, vor allem Individuelle. Um den Hinterbliebenen das Trauern zu erleichtern, gestalten zwei Hamburgerinnen individuelle Souvenirs. Diese Souvenirs werden speziell für die Verstorbenen angefertigt und sind ein ganz besonderes Erinnerungsstück. Nach einem Todesfall steht oftmals alles still. Es gibt allerdings einige Sachen, die erledigt werden müssen. Es muss ein Sarg ausgesucht […]
Schizophrenie gehört zu den endogenen Psychosen und ist eine gravierende psychische Erkrankung. Psychosen fassen allgemein Krankheitsbilder wie Wahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt zusammen. Endogen bedeutet, dass die Krankheit im Inneren entsteht und nicht mit äußeren Erlebnissen zusammenhängt. Charakteristisch für schizophrene Erkrankungen sind Störungen des Denkens und Wahrnehmens sowie inadäquate und verflachte […]
Wer krank ist, hilft sich mit der Fokussierung auf baldige Besserung über den Krankheitsalltag hinweg. Doch was ist, wenn diese Besserung niemals kommen wird? Wie können Menschen, die an unheilbaren Krankheiten leiden, ihren Alltag noch meistern? Welche Strategien verwenden sie, um nicht an ihrem Schicksal zu verzweifeln? Die Diagnose unheilbare Krankheit lässt so manchen in ein schwarzes […]
Der Begriff Messie kommt aus dem Englischen und beschreibt ein Phänomen, das man auch als „zwanghaftes Horten von Wertlosem“ bezeichnen kann. Wer unter dem Messie-Syndrom leidet, sammelt Dinge, die andere als unbrauchbar oder bestenfalls überflüssig betrachten würden. Da sich die Betroffenen nicht von diesen Dingen trennen können, versinken ihre Wohnungen meist im Chaos. In vielen Fällen ist […]
Bei der hebephrenen Schizophrenie handelt es sich um eine besondere Form der Schizophrenie. Veränderungen werden bei dieser Krankheitsform im affektiven Bereich angesiedelt. Die Krankheit wird manchmal auch als Hebephrenie bezeichnet. In früheren Jahren wurde die hebephrene Schizophrenie als „Läppische Verblödung“ oder „Jugendirresein“ bezeichnet. Solche Dinge werden in der heutigen Zeit natürlich als unangemessen angesehen. Später, […]
Der Tod ist ein Aspekt des Lebens. Auch wenn Menschen ihn zuoft aus ihren Gedanken zu verdrängen versuchen, so gehört er dennoch unwiderruflich zu einem Lebensverlauf dazu. Viele Menschen haben allerdings keine Angst vor dem Tod selbst, sondern vielmehr vor dem Sterben und dem Sterbeprozess. An dieser Stelle setzt die Hospizarbeit ein und hilft den Menschen, die belastende Zeit […]
ADHS beeinflusst nicht nur die Aufmerksamkeit der betroffenen Menschen, sondern auch das Selbstbild, das sie im Laufe ihres Lebens von sich entwickeln. Durch die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung erleben die Kinder und Jugendlichen oftmals negative Ereignisse und zahllose Rückschläge. Zudem können die Mitschüler das aufgedrehte und unruhige Verhalten der Betroffenen in den meisten Fällen nicht verstehen und lehnen sie […]
Wenn die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung im Raum steht, betrifft dies zumeist nicht nur die Person selbst, sondern auch ihr gesamtes Umfeld. Verwandte, Bekannte und Partner sind ebenfalls verunsichert und nehmen Anteil. Denn kaum ein Angehöriger weiß auf Anhieb, wie er mit dieser schwerwiegenden Erkrankung umgehen soll. Es gibt dafür auch keinerlei Richtlinien oder Gesetze. Wichtig ist vor […]
Der österreichische Arzt Hans Asperger war es, der in den 1940er Jahren die nach ihm benannte Krankheit erstmals beschrieben hat. Seiner Erkenntnis nach handelt es sich dabei um eine Entwicklungsstörung, die autistische Züge trägt. Anders als beim Autismus sind die Symptome beim Asperger Syndrom jedoch schwächer ausgeprägt. Jedoch besteht beim Asperger Syndrom leicht die Gefahr, sie mit […]