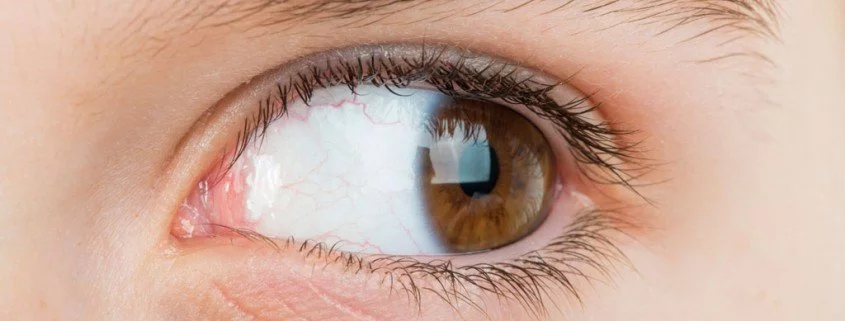Amerika hat gewählt. Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Psychologen sind sich bei der Analyse seiner Persönlichkeit äußerst uneins und stoßen teilweise an ihre ethischen Grenzen. Zahlreiche Ferndiagnosen durch Fachleute Der bekannteste amerikanische Experte für den Bereich Persönlichkeitsstörungen, Allen Frances, berichtete bereits im Wahlkampf, dass bei Donald Trump keine Spur einer psychischen […]
Schlagwortarchiv für: Persönlichkeitsstörung
Du bist hier: Home » Persönlichkeitsstörung
Beiträge
Die Depersonalisierung beschreibt den Verlust und die Veränderung des ursprünglichen Gefühls für die eigene Persönlichkeit. Man versteht unter diesem Syndrom eine bestimmte Form von psychischer Störung. Diese trifft bei Betroffenen auf, welche die eigene Person oder aber auch Personen innerhalb der Umgebung als verändert und fremd wahrnehmen. Oft geht damit auch ein Gefühl von Unwirklichkeit einher. Entfremdungserlebnisse, […]
Wer voyeuristisch veranlagt ist, zieht seine Erregung aus der Beobachtung. Der Begriff des Voyeurismus stammt vom französischen “voir” = “sehen”, “le voyeur” = “der Seher”. Meist sind es Männer, die eine Frau heimlich beobachten. Es erregt sie, wenn sie beim Auskleiden oder gar bei sexuellen Handlungen als Beobachter fungieren können. Meist befriedigt sich der Voyeur […]
Narzissten gelten als Selbstdarsteller. Sie sind in ihr eigenes Spiegelbild verliebt und komplett Ichbezogen. So denken zumindest die meisten Menschen über diese Persönlichkeit. Eine neue Hirnstudie belegt nun aber das, was Therapeuten schon längst wussten … Narzissmus wird als eine Art „Modediagnose“ dieser Zeit beschrieben. Vielen Menschen der heutigen Generation wird unterstellt, dass sie selbstverliebt […]