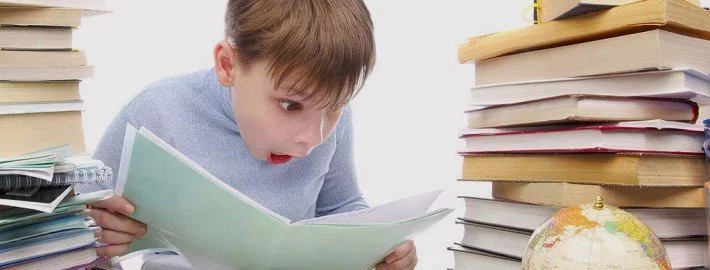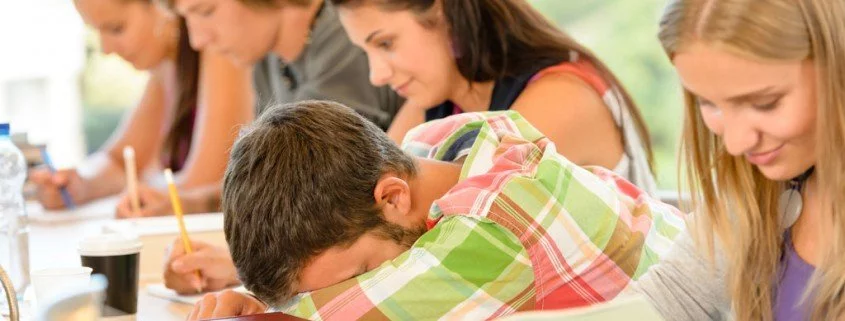Die Zahl der Ehescheidungen nimmt stetig zu und natürlich sollten hierbei die vielen Kinder nicht vergessen werden, die von der Trennung der Eltern ebenso betroffen sind, wie die Partner selbst. Hierbei sollten Entwicklungsunterschiede von Scheidungskindern und solchen, die in Kernfamilien aufgewachsen sind, betrachtet werden. In einer Kernfamilie leben die Kinder mit den leiblichen Eltern zusammen. […]
Schlagwortarchiv für: Kinder
Du bist hier: Home » Kinder
Beiträge
Ca. 150.000 Menschen sind von Autismus betroffen, ca. 300.000 Menschen leiden unter einer Autismus-Spektrum-Störung, einer abgeschwächten Abwandlung von Autismus. In beiden Fällen handelt sich um eine tief- und weitgreifende Störung der Entwicklung, die sich ca. im dritten Lebensjahr erstmalig zeigt. Für Eltern und Familien der betroffenen Kinder ist die Krankheit im doppelten Sinn eine Herausforderung. […]
Autismus ist eine ernstzunehmende Krankheit. Viele Psychiater und Wissenschaftler interessieren sich für dieses inzwischen weit verbreitete Syndrom und richten ihre Forschung darauf aus, denn besonders in den USA wird seit einigen Jahren ein rasanter Anstieg an Betroffenen beobachtet. Bislang ist die Ursache unklar, doch tagtäglich gibt es neue interessante Informationen, die bei der Behandlung und […]
Ob in der Schule oder beim Sport – gut reicht nicht mehr: Es geht nur noch darum der Beste zu sein. Der Druck der Leistungsgesellschaft macht auch vor Kindern nicht halt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass immer mehr Kinder und Jugendliche an Burn-out leiden, wie jetzt Michael Schulte-Markwort in seinem Buch festgestellt hat. […]
Religion in der Erziehung? Nicht zuletzt durch den Missbrauchskandal in der katholischen Kirche sehen sich viele in ihrer Meinung bestärkt, das Konzept der Religion sei ein längst überflüssig gewordenes Relikt vergangener Zeiten und habe seit Menschengedenken nur einem Zweck gedient: den Menschen unterwürfig zu machen. Diese Sichtweise mag arg überspitzt klingen, doch was in leidenschaftlichen Tiraden […]
Totaler Mutismus bezeichnet im fachmedizinischen Jargon das situationsübergreifende Schweigen, das einen Menschen befallen kann. Viel häufiger ist allerdings der selektive Mutismus, der bei Betroffenen dazu führt, dass sie nur in bestimmten Situationen schweigen und verstummen. Im ICD-10 wird der selektive Mutismus als emotional bedingte Stummheit in bestimmten Situationen beschrieben. Oftmals führt das Verstummen oder auch […]
Das Leben mit einem schwerkranken Kind ist für die Eltern, Geschwister und natürlich für das betroffene Kind selbst eine Qual. Der Alltag ist bestimmt von der Krankheit und einfache Unternehmungen scheinen oft unüberwindbare Herausforderungen zu sein. Besonders Reisen stellen oft eine enorme Anstrengung dar. Nicht nur für die kranken Kinder, auch für alle anderen Reisenden […]
Oft klingelt schon um 6.30 Uhr der Wecker der Kinder. Eine Stunde haben sie dann Zeit um zu frühstücken, sich anzuziehen, sich im Bad fertig zu machen, um dann zur Schule oder zur Kita zu gehen. Als Einzelkind ist das schon ziemlich viel Stress. Wenn man aber eine große Familie ist, kann so ein Morgen schnell […]
Sie wird in den Medien eher selten thematisiert, gehört jedoch bei Kindern und Jugendlichen zu den häufigsten Erkrankungen psychischer Natur: Schätzungen gehen davon aus, das bundesweit vier bis acht Prozent der Kinder und Jugendlichen an einer Depression leiden. Im Folgenden wollen wir klären, anhand welcher Symptome eine depressive Verstimmung bzw. Störung erkannt werden kann, welche […]
Depressionen werden längst als psychische Volkskrankheit bezeichnet. Oftmals haben wir ein bestimmtes Bild in unserem Kopf wie ein Depressiver aussieht, wie er sich verhält. Selten denken wir dabei daran, dass auch Kinder von dieser heimtückischen Krankheit betroffen sein können. Tatsächlich ist es sogar der Fall, dass die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlich in den […]
Einer Studie zufolge werden die Kinder und Jugendlichen in Deutschland immer unglücklicher. Man könnte meinen, es handle sich dabei um ein Jammern auf höchstem Niveau, dabei liegt hier ein tiefer gehendes Problem zugrunde. Die Lebensbedingungen in unserem Land sind sehr viel besser, als in anderen Ländern und doch fühlt sich die junge Generation zunehmend unglücklich. Dies zeigt eine […]
Kinderstars begeistern ein Millionenpublikum, allerdings hat der schnelle Ruhm auch seine Schattenseiten. Der Druck auf jeden Star, egal ob als Sänger oder Schauspieler, ist enorm hoch. Womit Erwachsene schon kaum fertig werden, belastet Kinder umso mehr. So kommen die Kinder meist aus einer ganz normalen Kindheit und stehen von einem Moment zum Anderen plötzlich im Rampenlicht. Dieser frühe […]
In einer Studie der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig haben sich Prof. Dr. Elmar Brähler und sein Expertenteam mit dem Zusammenhang psychosozialer und geographischer Faktoren bei der Entstehung von Übergewicht im Kindesalter beschäftigt. Rund 15 % der Kinder in Deutschland sind übergewichtig und alarmierende 6 % von ihnen sogar bereits adipös. Ist es doch noch jedem […]
Die Eltern-Kind-Beziehung ist eine besondere zwischenmenschliche Beziehung. Eltern kümmern sich um ihr Kind und für viele ist die Geburt des Nachwuchses der Schritt zu einer “echten Familie”. Die Eltern-Kind-Beziehung verändert sich dabei im Verlauf des Lebens und von einer beschützenden Beziehung geht das Verhältnis irgendwann in eine gleichberechtigte Stellung über. Die Eltern-Kind-Beziehung im Verlauf des Lebens […]
In den letzten Jahren ist immer häufiger von der Überlastung von Studenten und Schülern die Rede. Die Anforderungen in den Bildungseinrichtungen werden immer höher und dies zeigt sich deutlich, wenn man die Belastung der Psyche bei Kindern und Studenten betrachtet. In diese Richtung zielt auch der Stress-Test der Universiät Bielefeld, die diesen in Kooperation mit […]
Egal wie alt Kinder werden, selbst wenn sie schon erwachsen sind, haben ihre Eltern gewisse Ansprüche an sie. Sie wünschen sich, dass es ihren Kindern gut geht und dass aus ihnen etwas wird. Umgekehrt möchten die Kinder ihre Eltern stolz machen und ihren Ansprüchen genügen. Aber nicht selten passen die Anforderungen der Eltern nicht mit […]
Dass Kinder offensichtlich an einer Konzentrationsschwäche leiden, fällt meistens im Kindergarten oder während der Schulzeit auf. Die betroffenen Kinder stören den Unterricht, spielen den Klassenclown und werden mitunter sogar aggressiv. Dass die Ursache für diese Verhaltensauffälligkeiten in einer Störung der Konzentrationsfähigkeit liegt, wird leider nicht immer rechtzeitig erkannt, denn im Vordergrund stehen zunächst die unangenehmen […]
Eltern schicken ihre Kindern in den Schulferien gerne mal in Ferienlager. Oftmals erleichtern diese Ferienangebote für Eltern die eigene Urlaubsplanung auf der Arbeit und zudem erfahren Kinder in Ferienlager oftmals ein tolles Unternehmungsangebot sowie ein schönes Miteinander mit anderen Kindern. In einer Studie der University of Chicago wurde nun ein weiterer Nutzen von Ferienlagern eruiert: […]
Frühförderung ist heute ein allgegenwärtiger Begriff. Die Kinder werden in Klavierunterricht, Babyschwimmen und manch andere Kurse geschickt. Immer dabei sind die Eltern. Sie möchten mit der Frühförderung erreichen, dass ihr Kind ganz oben mitmischt und später die besten Chancen hat. Doch wenn nur der Beste zählt, welche Chancen haben dann die Dritten? Und zugleich: Frühförderung […]
Laut einer neuen US-Studie sind bereits bei Kindern im Alter zwischen sechs und sieben Jahren Geschlechterklischees zwischen Jungen und Mädchen stark ausgebildet. Mädchen halten dabei Männer für schlauer und Jungs trauen sich stets viel zu. Geschlechterklischees schon in jungen Jahren ausgeprägt Der Geschlechter-Stereotype sei, laut den Berichten von Psychologin Lin Bian und ihrem Team von der University […]