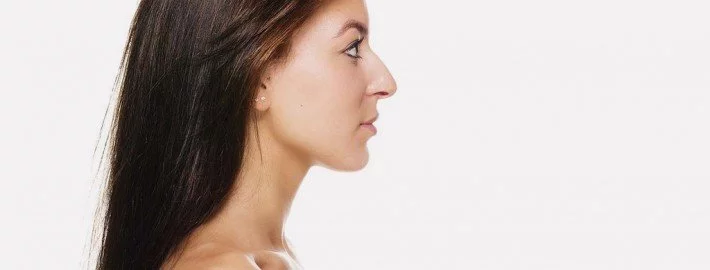Was mehr nach esoterischem Unsinn klingt, wird nun auch wissenschaftlich belegt: die Jahreszeit, in der wir geboren werden, entscheidet darüber, welches Temperament wir aufweisen. Sommerkinder seien demnach eher Stimmungsschwankungen unterworfen als Winterkinder. Auch Krankheiten lassen sich laut dem Psychologen Helmuth Nyborg anhand der Jahreszeiten gruppieren. Kinder, die im Frühling geboren worden sind, leiden beispielsweise seit […]
Schlagwortarchiv für: Charakter
Du bist hier: Home » Charakter
Beiträge
Führungstypen sind ganz andere Menschen. Ist das der Grund für ihren Aufstieg? Da hält sich aber jemand für wichtig! Wie er herumstolziert! Dabei gehörte er früher mal zu den Normalsterblichen. Er war immer hilfsbereit und immer für ein Feierabendbier zu haben. Doch vor drei Jahren kam dann der Tag, an dem sich alles ändern sollte, […]
Irren ist menschlich, das gilt auch für die Beurteilung von Fremden. Nicht jeder und jedem ist das gegeben, was man als „Menschenkenntnis“ bezeichnet. Die Fähigkeit, den Charakter einer anderen Person schnell, nach Möglichkeit schon im ersten Moment der Begegnung zu erfassen, basiert auf Erfahrung, guter Beobachtungsgabe und nicht zuletzt auf Intuition und Selbstbewusstsein. Sie hat […]
Haben wir die Möglichkeit unsere Gene und daraus resultierendeVerhaltensmerkmale zu beeinflussen, oder nicht? Wie hoch ist der Anteil von dem, was uns unsere Eltern vererbt haben und wie viel Bedeutung erhält die Erziehung und unser Umfeld in unserer persönlichen Entwicklung? Dass wir viele Bereiche unseres Lebens selbst in der Hand haben, scheint uns logisch, doch […]
Seit jeher ist es der Wunsch des Menschen, sein Gegenüber zu erforschen. Die Vorstellung, allein über das äußere Erscheinungsbild einer Person Rückschlüsse über seinen Charakter zu erlangen beschäftigte über die Jahrhunderte die Forscher in aller Welt. Der aus Schwaben stammende Mediziner Joseph Gall behauptete gegen Ende des 18. Jahrhunderts sogar, dass er an der Kopfform […]
Unsere Stimme spiegelt häufig wieder wie es uns gerade geht. Sind wir unsicher, beginnt sie zu zittern, regen wir uns auf, wird sie schrill oder wollen wir jemanden überzeugen, dann bemühen wir uns um einen festen und ruhigen Tonfall. Forscher haben nun untersucht, ob auch Depressionen anhand unserer Stimmlage zu erkennen sein könnten. Sogar Babys […]
Im Alltag wird der Begriff der Persönlichkeit recht häufig verwendet: Man spricht beispielsweise bewundernd von Menschen mit Persönlichkeit. Aber was ist das eigentlich genau und wie und wann bildet sie sich heraus? Zu diesem Thema gibt es verschiedene Persönlichkeitstheorien. Hier begegnen uns u. a. Sigmund Freud, Carl Rogers, William Stern, Erik H. Eriksen und Paul […]