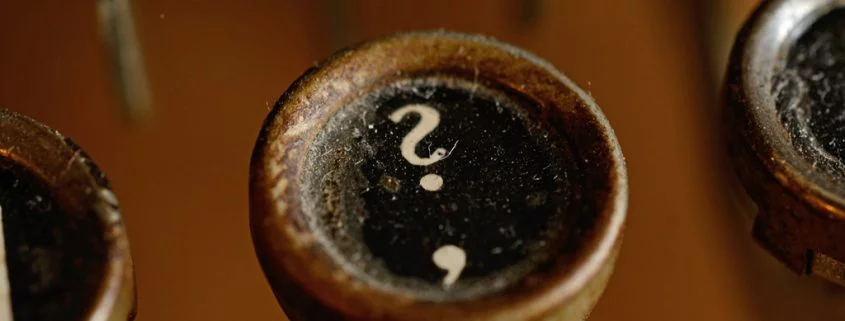Die Diagnose Krebs verändert das Leben eines Betroffenen ganz immens und auch das seiner Angehörigen. Krankenhausbesuche, Chemotherapien und schwere Nebenwirkungen sind nur eine Reihe von belastenden Faktoren, die einem Krebspatienten das Leben buchstäblich erschweren. Gar nicht erst zu sprechen von einem Todesfall durch Krebs. Psychoonkologen sind jene Menschen, die Betroffenen in jeder Hinsicht zur Seite […]
Schlagwortarchiv für: Krebs
Du bist hier: Home » Krebs
Beiträge
Eine Krebsdiagnose bringt das Leben von heute auf morgen völlig durcheinander. Der Alltag wird fortan bestimmt von Arztterminen und Ungewissheiten. Dazu kommt Haarausfall als eine Nebenwirkung der Chemotherapie. Eine Perücke, als Begleiterin für eine gewisse Zeit, kann zu mehr Selbstbewusstsein und Stärke führen und so helfen, den Krebs auch mental zu besiegen. Der psychische Aspekt […]
Die Diagnose Krebs trifft die meisten unvorbereitet und plötzlich. Noch viel stärker ist das, wenn es sich um Kinder handelt. Da erwartet man es ja zu allerletzt. Das Leben verändert sich mit einem Schlag. Nicht nur der Betroffene muss lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Auch der Alltag als Angehöriger, Freund oder Geschwister eines krebskranken […]
Die Menschen glauben scheinbar immer mehr an Verschwörungstheorien, an dunkle Mächte und an „Das Böse“, das für bestimmte Ereignisse verantwortlich ist. Doch woher kommen diese Theorien überhaupt? Kurz und knapp zusammengefasst: wichtige Fakten über Verschwörungstheorien. Ein Blick in das Internet zeigt immer mehr Beiträge, in denen Menschen „andere Erklärungen“ für schreckliche Ereignisse und Geschehnisse wie […]
Der Satz “was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß” ist hinlänglich bekannt. Oftmals ist es besser eine Sachlage nicht zu wissen, um unvoreingenommen und eventuell besser damit umgehen zu können. Das ist vor allem im medizinischen Bereich der Fall. Vor einigen Jahren gab es eine sehr hitzige Diskussion in den Medien um das Thema […]