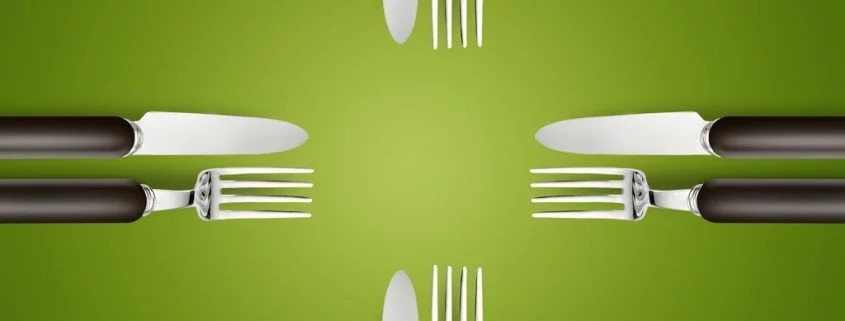Dass einige Lebensmittel im Verdacht stehen Krebs auszulösen oder zumindest das Krebsrisiko zu erhöhen, ist schon lange nichts neues mehr. Genau deshalb, sollte immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, welch großen Einfluss die richtige Ernährung auf unsere Gesundheit haben kann. Deshalb rief der Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) 1998 erstmals zum Tag der […]
Schlagwortarchiv für: Krebs
Du bist hier: Home » Krebs
Beiträge
Brustkrebs: Eine schlimme Diagnose, die heute immer mehr Frauen im mittleren Alter trifft. Doch sie muss nicht das Ende bedeuten, denn gerade wenn er früh erkannt wird, ist Brustkrebs gut behandelbar. Zur Heilung können vom Brustkrebs betroffene Frauen auch selber beitragen, denn die Ernährung und körperliche Fitness durch Sport helfen dabei. Unterstützend zu einer Behandlung […]
Der „Diätenwahn“, wie man die nahezu zwanghafte Abnehmkultur, die viele Menschen heutzutage betreiben, inzwischen nennen kann, bringt auch einen veränderten Umgang mit Lebensmitteln und Essen im Allgemeinen mit sich. Die Medien greifen diese Themen natürlich zur Gänze auf und sind Teil des Systems rund um die perfekte gesunde Ernährung und den perfekten Körper. Es versteht […]
Bei niedrigen Temperaturen greifen viele Menschen gerne zu Tee. Tee ist nicht nur in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich, sondern auch noch gesund. Durchschnittlich trinken die Deutschen 20 Liter Schwarztee im Jahr. Damit ist diese Sorte eine der beliebtesten überhaupt. Eine Untersuchung der Stiftung Warentest von 27 Schwarzteesorten hat nun allerdings ergeben, dass viele Teemischungen potenziell krebserregende […]
Eine topaktuelle, aber bereits jetzt umstrittene Studie der Universität Graz erhitzt die Gemüter: Vegetarier sollen häufiger an Krebs, Asthma und psychischen Erkrankungen wie Depressionen leiden als Fleischesser. Zudem sollen sie häufiger einen Herzinfarkt erleiden oder sich mit Allergien herumschlagen. Aus diesem Grund sollen sie mehr Leistungen aus dem Gesundheitssystem beanspruchen und auch ihre Lebensqualität sei insgesamt niedriger. Die […]
Hauptbestandteil einer gesunden Ernährung sind bekanntlich Obst und Gemüse. Ernähren wir uns gesund, kann uns dies vor vielen Erkrankungen schützen. Auch die Krebsprävention gehört dazu. Wissenschaftler haben nun festgestellt, dass der Verzehr von Obst in jungen Jahren spätere Krebserkrankungen vorbeugt. Besonders bei jungen Mädchen, die im Kindesalter viel Obst essen, ist später das Brustkrebs-Risiko deutlich […]