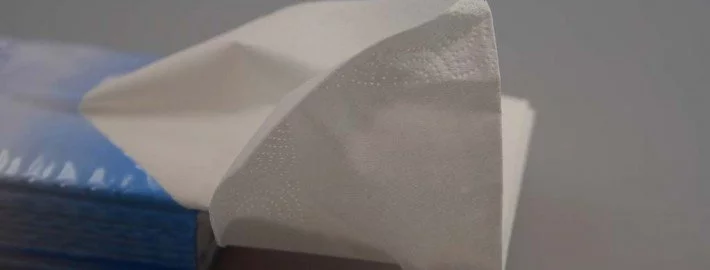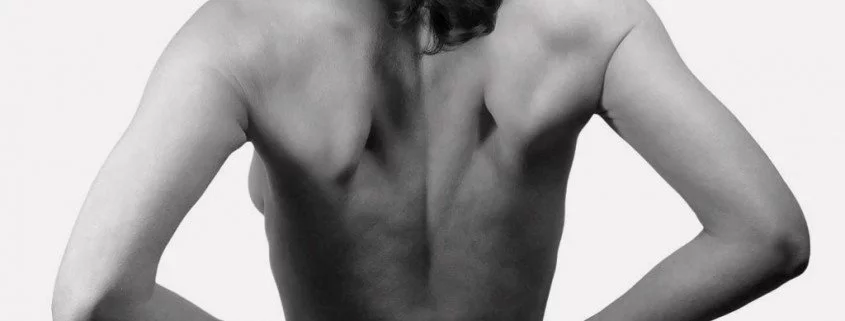Brauchen Medikamente wirklich teure Inhaltsstoffe? FDP und Union haben einen Durchbruch erreicht: Amnog, das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Die neu verhandelten Regelungen zur Kontrolle und Regulation von Arzneimittelpreisen galt bisher jedoch nur für Medikamente, die nach Inkrafttreten des Gesetzes zugelassen wurden. Das soll sich nun ändern. Auch […]
Archiv für die Kategorie: Therapie & Verfahren
Du bist hier: Home » Therapie & Verfahren » Seite 19
Gesundheit Therapie & Verfahren
Während die einen sich über die ersten Sonnenstrahlen und den anbrechenden Frühling freuen, schwant einigen anderen bereits nichts Gutes. Denn Frühlingszeit bedeutet für viele Betroffene leider auch immer Heuschnupfenzeit. 15 bis 30 Prozent der Deutschen leiden an der unangenehmen Pollenallergie und stehen jedes Jahr vor der Frage, wie sie ihre Symptomatik am besten lindern können. […]
Unter dem Begriff künstliches Koma versteht man eine Art der Langzeitnarkose. Der Begriff Koma ist gleichbedeutend mit „tiefer oder fester Schlaf“. Wird ein Patient in ein künstliches Koma versetzt, so geschieht dies meist aus gutem Grund. Oft wenden Ärzte das künstliche Koma nach Unfällen oder bei lebensbedrohlichen Krankheiten an. Während dieser Dauer wird der Patient […]
Wer ein Medikament verschrieben bekommt oder es sich rezeptfrei in der Apotheke kauft, findet in der Regel einen mehr oder weniger umfangreichen Beipackzettel in der Packung vor. Natürlich ist es sinnvoll, sich vor der ersten Einnahme über Inhaltstoffe, die Dosierung sowie Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen zu informieren. Leider sind viele dieser Beipackzettel sehr kompliziert geschrieben. […]
Wie sollte man Schmerzmittel richtig einnehmen? In jeder Hausapotheke finden sich Schmerzmittel, meist in Form von Schmerztabletten. Sie helfen bei akuten Schmerzen wie etwa Kopfschmerzen, Zahnschmerzen usw. Bei der Einnahme gilt es jedoch bestimmte Regeln einzuhalten. Nur so können diese Mittel ihre volle Wirkung entfalten und der Betroffene schadet sich nicht durch eine falsche Einnahme. […]
Vergessen? – Das kann an der Menopause liegen Neueste Studienergebnisse belegen, dass ein Frau, die sich unmittelbar nach der Menopause befindet, ein sehr schlechtes Gedächtnis hat. Nach und nach kehrt die Leistungsfähigkeit allerdings wieder zurück. Es gibt also keinen Grund zur Sorgen. Wie oft passiert es, dass einem ein Name entfallen ist oder man nicht mehr weiß, […]
Immer wieder verwenden Heilpraktiker die Eigenbluttherapie. Kaum jemand kann sich allerdings genau vorstellen, was diese Therapie bringt und wie sie funktioniert. Dabei basiert das System auf einem einfachen Prinzip: Das eigene Blut wird als externer Reiz verwendet. Vereinfacht ausgedrückt wird das eigene Blut dazu verwendet, die Selbstheilung des Körpers zu unterstützen und anzuregen. Das Prinzip […]
Jennifer Schermann verstarb mit 20 Jahren an einer Herzmuskelentzündung. Diese Meldung ging in den vergangenen Tagen durch die Medien. Bei der Entzündung des Herzens handelt es sich keineswegs um eine seltene Erscheinung. In den meisten Fällen verlaufen die Erkrankungen allerdings symptomlos, sodass sie nur selten lebensbedrohlich werden. Was ist die Herzmuskelentzündung? Herzmuskelentzündungen können durch verschiedene […]
Der Sommer hat sich gerade verabschiedet und die Natur zeigt wieder ihre bunte Farbenpracht. Trotz der Lieblichkeit des Herbstes birgt die Jahreszeit gesundheitliche Gefahren. Erkältungen, grippale Infekte und Magen-Darm-Erkrankungen treten jetzt wieder vermehrt auf. Eine Herbstkur kann in diesem Zusammenhang helfen, die Gesundheit zu bewahren und auch das seelische Gleichgewicht und Wohlbefinden wiederherzustellen. Spuren des […]
Die Wirbelsäule ist besonderen Belastungen ausgesetzt. Daher gibt es viele Therapieformen, die sich auf die Stütze des Rückens spezialisiert haben. Schließlich können Fehlstellungen und Probleme im Mittelpunkt des knöchernen Aufbaus vielfältige Schäden auslösen, die bis zur Lähmung eines Körperteils reichen können. Eine mögliche Therapieform ist in diesem Zusammenhang die Wirbelsäulentherapie nach Dorn. Grundlagen und Natur […]