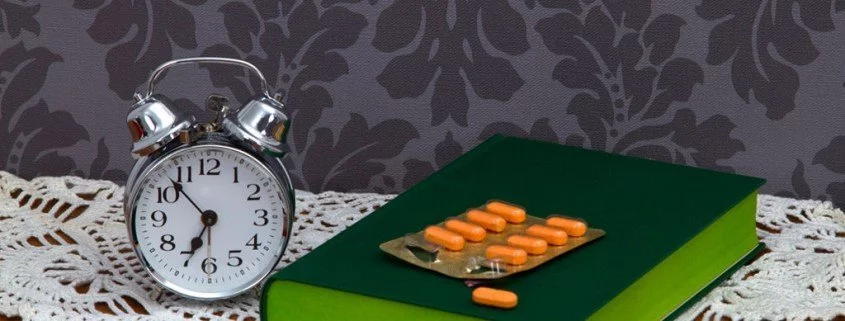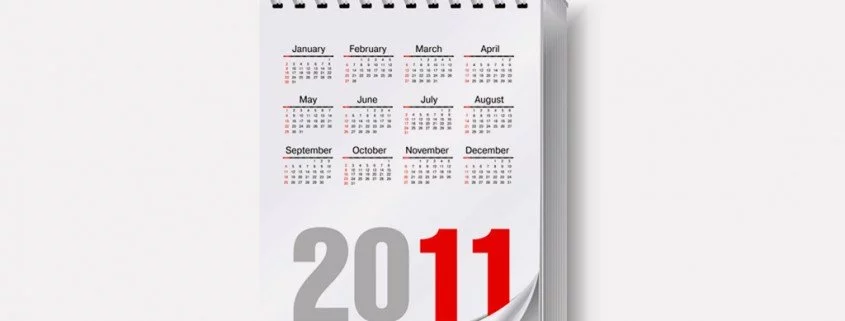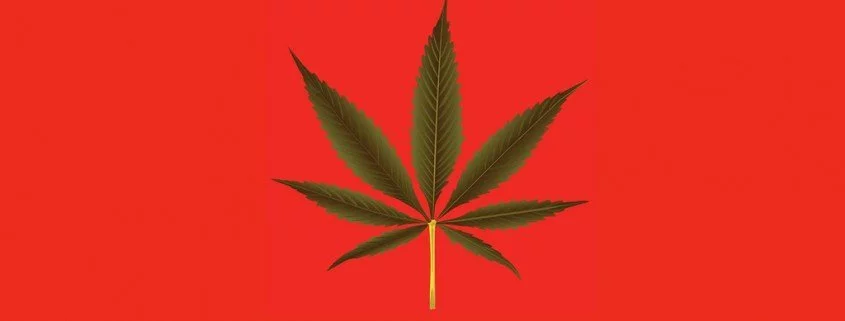Die E-Zigarette wird immer beliebter. Die Verkaufszahlen der modernen Qualmstängel können ständig gesteigert werden. Viele Raucher nutzen die elektrischen „Tabakartikel”, um in geschlossenen Räumen ungestört ihrer Sucht nachzugehen. Die Hersteller betonen immer wieder die vermeintlichen Vorteile der Geräte. Doch gerade in letzter Zeit werden auch kritische Stimmen laut, die nicht nur einen Umsatzrückgang für die […]
Beiträge
Heroin wird zum Problem in den USA: War es früher die arme Stadtbevölkerung, die Heroin konsumierte, so ist der Konsum von Heroin mittlerweile in die Mittelschicht der amerikanischen Bevölkerung vorgedrungen. Im Jahre 2013 galt bereits eine halbe Million Amerikaner als heroinabhängig und über 8000 waren an einer Überdosierung gestorben. Als Ursache wird der freizügige Umgang […]
Erschreckend hoch ist die Zahl derer, die ohne Beruhigungs- oder Schlafmittel nicht mehr leben können. Schätzungsweise 1 Millionen Menschen in Deustchland sind Schlafmittelsüchtig. Ein Pilotprojekt nimmt sich nun dieser Tatsache an und erarbeitet die Bedeutung der Warnung von Seiten der Ärzte und Apotheke vor den Folgen einer Schlafmittelsucht. Die Schlafmittelsucht ist ein Symptom unserer neuzeitlichen […]
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mechthild Dyckmans, gab am 22.05.2012 den alljährlichen Drogensuchtbericht bekannt. Nach den Informationen des Berichts, gab es im Jahr 2011 erfreuliche Entwicklungen in diesem Bereich. Jugendliche weniger gefährdet- junge Erwachsene und ihr Risikoverhalten Die Drogenbeauftragte erklärte, dass sowohl der Tabakkonsum als auch der Alkoholkonsum und die Einnahme von Cannabisprodukten im vergangenen Jahr […]
Seit dem Tod von Peaches Geldof am 7. April 2014 hält die Welt den Atem an. Eine 25-jährige Frau gestorben an einer Heroin-Überdosis? Ein furchtbares Schicksal und allerhand Fragen bleiben zurück. Die Tochter des Rocksängers Bon Geldof wurde im April tot in ihrer Wohnung aufgefunden und eins scheint klar zu sein: Heroin war im Spiel. Dass […]
Cannabis ist eine der am weitesten verbreiteten Drogen. Sie gilt unter Konsumenten als harmlos und auch viele Nicht-Konsumenten stufen sie als verträglich ein. Dennoch: Psychosen, die durch Drogen ausgelöst werden, sind in diesem Zusammenhang weit häufiger zu finden, als allgemein bekannt ist. Dies gilt nicht nur für die harten Drogen. Auch das relativ “weiche Cannabis” […]
Eine Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, brachte erstaunliche Erkenntnisse ans Licht. Zucker soll beim Menschen ganz ähnliche Suchtreaktionen verursachen, wie es bei Nikotin oder Kokain der Fall ist. Dies ist jedenfalls das Ergebnis, dass bei Versuchen mit Ratten erzielt wurde. Im Rahmen der Untersuchungen wurde Ratten der Zucker entzogen, sozusagen ein Entzug erzeugt. Daraufhin […]
Heroin ist eine gefährliche Droge, das ist bekannt. Sie macht süchtig und führt in eine psychische und physische Abhängigkeit. Gerade das macht es vielen Abhängigen so schwer, von dieser Droge loszukommen. Selbst wenn der harte körperliche Entzug geschafft ist, bleibt noch immer die Erinnerung daran, dass es scheinbar eine weitere Möglichkeit gibt, sich aus der […]
Die Rauchentwöhnung ist für viele Raucher ein Thema. Oft wird versucht, Hilfsmittel einzusetzen, die dann dafür sorgen sollen, dass die Auswirkungen der Rauchentwöhnung weniger gravierend sind. Die Homöopathie bietet hier einige Möglichkeiten, um die Entwöhnung zu erleichtern. Doch auch mit dem Mitteln gilt: Ohne starken Willen, ist es nicht zu schaffen. Von der Einnahme von […]
Immer wieder werden neue Gesetze und Richtlinien verabschiedet, um es der rauchenden Bevölkerung so richtig ungemütlich zu machen: Waren erst nur Restaurants von dem Nichtraucher-Gesetz betroffen, so folgten wenig später auch Diskotheken und Kneipen, die dadurch einiges an Gewinn-Einbußen wegstecken mussten. Der neuste Schachzug der Bundesregierung in dieser Richtung soll das Abdrucken von Schockbildern auf Zigarettenpackungen im […]