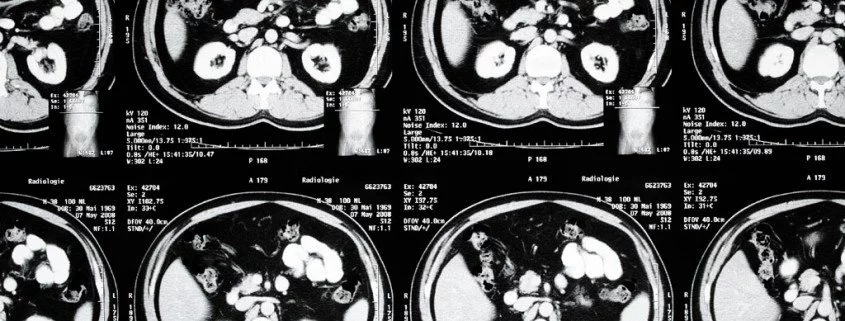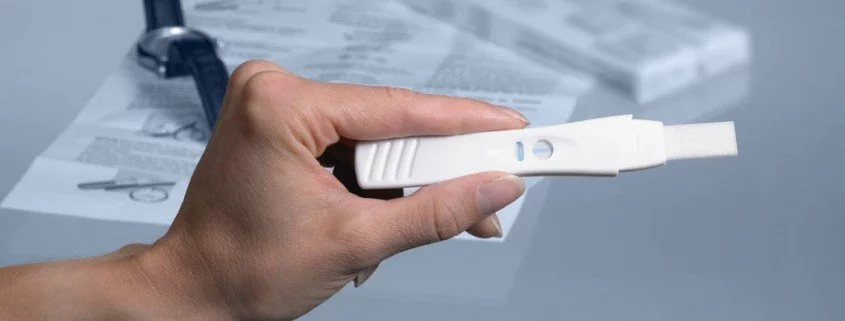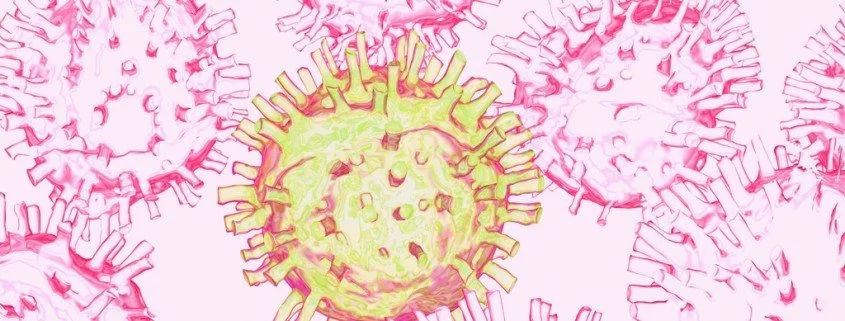Man hüpft und schüttelt, doch es scheint nichts zu nützen, das Ohr bleibt verstopft. Meist passiert es nach dem Duschen oder einem Besuch im Schwimmbad. Von Wattestäbchen und anderen Hilfsmittel raten Ärzte jedoch ab. Wenn alles gedämpft klingt und auch Schütteln nicht hilft, sollte man zum Arzt gehen und sich die Ohren reinigen lassen, rät […]
Archiv für die Kategorie: Krankheitsbilder
Du bist hier: Home » Krankheitsbilder » Seite 7
Gesundheit Krankheitsbilder
Nach Demenz zählt die Parkinson-Krankheit zu den häufigsten degenerativen Erkrankungen des zentralen Nervensystems in Deutschland. Die bislang unheilbare Krankheit belastet die derzeit etwa 300.000 Betroffenen Patienten nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Für alle, die das Glück haben der generativen Erkrankung nicht zum Opfer zu fallen, ist die Belastung durch Parkinson wohl kaum vorstellbar. Um […]
Diabetes ist eine schwere Krankheit, die den Betroffenen erhebliche Nachteile im täglichen Leben, aber auch in Hinsicht auf ihre generelle Gesundheit und Überlebenschancen bringen. Deshalb werden weltweit Projekte vorangetrieben, in denen neue Behandlungsmethoden erprobt werden. Auch in Deutschland ist Diabetes ein Problem, neusten Schätzungen zu Folge sind sechs Millionen Menschen von der Autoimmunerkrankung oder Insulinresistenz […]
Viele Eltern befürchten eine Operation, wenn sich bei ihren kleinen Jungen die Vorhaut nicht zurückschieben lässt. Dabei ist die Vorhautverengung, die sogenannte Phimose, bei kleinen Jungen vollkommen normal. Die Verklebung löst sich in den ersten drei Lebensjahren in der Regel wieder. Erst wenn sie sich nicht zurückbildet und bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt, ist eine […]
Der Reizmagen ist eine unangenehme, aber nicht wirklich gefährliche Krankheit. In der Medizin spricht man hier von einer funktionellen Dyspepsie. Die damit verbundenen Beschwerden können die Lebensqualität für den Betroffenen erheblich einschränken. Der Volksmund bezeichnet den Reizmagen auch als „nervösen Magen“ was schon erahnen lässt, dass der Körper hier oft auf psychische Belastungen reagiert. In vielen Fällen […]
Erschreckende Wissenslücken bei der Brustkrebs-Vorsorge Diagnose Brustkrebs – etwa 75.000 Frauen erkranken jährlich in Deutschland an dem bösartigen Tumor. Meist betrifft es Frauen zwischen 50 und 70. 2010 starben über 17.500 Frauen daran. Etwa 100.000 Brustentfernungen wurden im Jahr 2011 durchgeführt. Wie sehen die Heilungschancen aus? Brustkrebs – früh diagnostiziert – ist durchaus heilbar. Wenn der Tumor […]
Ein Kind zu bekommen, stellt für viele Paare einen großen Wunsch dar. Geht dieser dann nicht in Erfüllung, ist das für das Paar eine große psychische Belastung. In Europa bekommen etwa ein bis zwei Prozent der Frauen im Alter von 20 bis 44 Jahren kein erstes Kind. Und etwa zehn Prozent der Frauen, die bereits […]
Senken Joghurt und Limetten den Blutdruck? Einen, über das gewöhnliche Maß hinaus, erhöhten Druck bezeichnet man in der Medizin als Hypertonie. Hoher Blutdruck ist eine typische Zivilisationserkrankung, von der in der westlichen Leistungs- und Beschleunigungsgesellschaft viele Menschen betroffen sind. Wer die Dauerbelastung des Körpers durch blutdrucksenkende Medikamente reduzieren will, dem kann eventuell die Natur- und Erfahrungsmedizin […]
Ist ein Mensch am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, so kommt es dabei zu Symptomen, die man leicht mit einer gewöhnlichen Erkältung verwechseln könnte. Auslöser ist hierbei jedoch der sogenannte Epstein-Barr Virus. Diese, sehr ansteckende Krankheit, wird im Volksmund auch gern als „Kusskrankheit“ bezeichnet. So erkennt man das Pfeiffersche Drüsenfieber Wie der Name „Kusskrankheit“ schon erahnen lässt, ist das […]
In den vergangenen drei Jahren haben Experten einen „sehr auffälligen“ und vor allem beunruhigenden Anstieg von Syphilis-Neuinfektionen in nahezu allen Industrieländern verzeichnen müssen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte in seinem Infektionsepidemiologischen Jahrbuch die aktuellen Zahlen und versuchte, die Ergebnisse zu deuten. Was genau ist Syphilis, wie kann man sich anstecken und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Syphilis ist […]