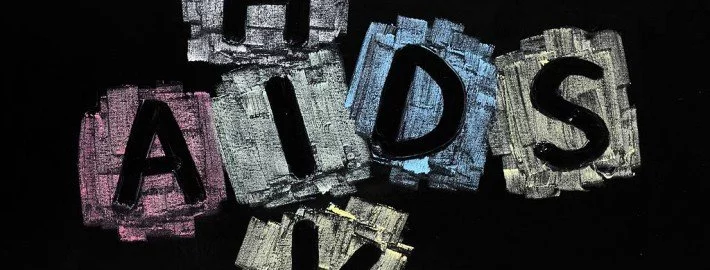Das Ebola-Virus hat die letzten Jahre für Angst und Schrecken gesorgt. Doch seit einigen Monaten scheint es nahezu gebannt respektive unter Kontrolle gebracht zu sein, sodass Mediziner mit einem gänzlichen Rückgang des Ebolavirus in absehbarer Zukunft rechnen. Doch immer wieder neue Erkenntnisse sorgen für Unruhe und Verunsicherung. Forscher haben nun eruiert, dass das Ebolavirus bis […]
Archiv für die Kategorie: Forschung & Wissenschaft
Du bist hier: Home » Forschung & Wissenschaft » Seite 12
Gesundheit Forschung & Wissenschaft
Der Super-GAU in Fukushima und generell die Gefährlichkeit, die mit der Arbeit und dem Leben im Bereich von Atomkraftwerken einhergeht, lässt die Bevölkerung vorsichtig handeln. Nun bestätigt eine Studie, was die große Angst einiger Bürger war: Es gibt einen Zusammenhang zwischen hoher radioaktiver Strahlung und lebensgefährlichen Krankheiten. Bei einem früheren Angestellten aus Fukushima wurde nun […]
Man wundert sich immer, dass manche Menschen unter Stress ganz anders reagieren. Einige laufen zu Hochtouren auf und können besonders produktiv arbeiten, während Andere von Erkältungen, fiesen Herpesbläschen und Kopfschmerzen geplagt werden. Eine neue Studie der Weltgesundheitsorganisation hat sich nun mit einem dieser Symptome genauer beschäftigt und eruiert, dass zwei von drei Menschen das Herpes-Virus […]
Eine sensationelle Nachricht, die da vor kurzem durch die Medien ging: Bereits das zweite mit dem HI-Virus infizierte Baby konnte von der HIV-Infektion befreit werden. Wissenschaftler um Deborah Persaud von der Johns Hopkins University School of Medicine stellten neulich auf der Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections den Fall eines weiblichen Babys vor, das vom HI-Virus befreit worden […]
Der Herzinfarkt, im medizinischen Fachjargon auch Myokardininfarkt genannt, ist inzwischen zur Volkskrankheit geworden. Der Forscher Kiran Munsunuru will sich nun einer Methode bedienen, die Herzinfarkte möglicherweise sogar verhindern kann. Die Technik ist nobelpreisverdächtig und so ihre beiden Entdeckerinnen. Crispr/Cas9 Der Stammzellenforscher Munsunuru bedient sich eines gentechnischen Verfahrens mit dem komplizierten Namen Crispr/Cas9. Die Erwartung an […]
Die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland steigt kontinuierlich an. Laut neuster Erhebungen sind mehr als die Hälfte der deutschen Frauen übergewichtig. Dass sich diese Tatsache auf alle Lebenslagen auswirkt, ist zu erwarten. Eine schwedische Studie hat sich nun zur Aufgabe gemacht die Auswirkungen für Neugeborene von übergewichtigen Müttern eruiert. Verschiedene Studien deuten bereits daraufhin, […]
Speicheltests sind in der Medizin zwar ein gängiges Verfahren um bestimmte Krankheiten zu identifizieren – aber lange nicht alle, und meist nicht als einziges, ausschlaggebendes Testverfahren. Um so verwunderlicher scheint es, dass Patienten inzwischen sogar die Angebote wenig seriös scheinende Anbieter in Kauf nehmen, wenn der Hausarzt diese Verfahren nicht anbietet oder eben schlicht weg […]
Patienten und Ärzte sind skeptisch Der technische Fortschritt ist kaum noch aufzuhalten. In öffentlichen Verkehrsmitteln tummeln sich ganze Rudel von High-Tech-Verrückten, die wie wild auf ihren Smartphones oder Tablets herumtippen. Auch in Restaurants und anderen sozialen Begegnungsstätten sind die kleinen Helfer nicht mehr wegzudenken. Doch wie sieht es im professionellen Kontext aus? Welchen Einfluss hat der technische […]
Das Humane Immundefizienz-Virus, eher bekannt in seiner abgekürzten Form als HIV, gilt als Auslöser des Immunschwächesyndroms AIDS. Seit Beginn der Pandemie in den Achtziger Jahren ist die Wissenschaft auf der Suche nach einem Heilmittel und nach Impfstoffen, doch ist man des Virus bisher nicht Herr geworden. Jetzt gibt es neue Hoffnung sowohl auf einen Impfstoff als […]
Wer würde nicht gerne kontrollieren können, was er träumt? Fiese Albträume können uns tagelang nachhängen und die schönen Träume sind doch leider sehr selten. Forscher haben nun heraus gefunden, dass Träume sich durch Stromimpulse zwischen 25 und 40 Hertz beeinflussen lassen. Hoffnung soll diese Erkenntnis vor allem für Opfer von Albträumen. Die Studie im Detail […]