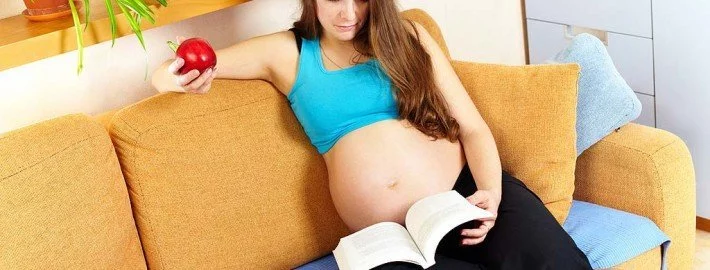Für uns Frauen ist es ein nahezu tägliches Brot, dass wir halbjährlich zum Gynäkologen gehen, um uns sowohl der Krebsvorsorgeuntersuchung als auch weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Es hat sich nun gezeigt, dass es in ganz Deutschland nur fünf gynäkologische Praxen gibt, die für behinderte Frauen zugänglich sind und dass auch in diesem Bereich noch immer […]
Schlagwortarchiv für: Frauenheilkunde
Du bist hier: Home » Frauenheilkunde
Beiträge
Ständig müde, erschöpft und ausgelaugt? Anfällig für Infektionen? Vermehrte Allergien? Oder klappt das trotz aller Bemühungen nicht mit dem ersehnten Nachwuchs? Da gibt es viele Möglichkeiten für Verdachtsdiagnosen. Es könnte aber auch Endometriose sein. Über 30.000 Neuerkrankungen gibt es pro Jahr. Etwa sieben bis 15 Prozent aller Frauen im geschlechtsreifen Alter erkranken an Endometriose. Das sind in […]
Es beginnt in der Pubertät und endet erst rund 30 Jahre später in der Menopause: Viele Frauen tragen ein monatliches Kreuz, denn sie plagen sich Zeit ihres Lebens mit mäßigen bis starken Periodenschmerzen. Glücklich seien diejenigen, welche davon verschont bleiben, jedoch gibt es auch für Betroffene Hilfe. Dieser Artikel soll Ihnen fünf einfache Tipps aufzeigen, mit […]
Erst kürzlich wurde in Göteborg die erste Gebärmuttertransplantation vorgenommen. Es handelte sich dabei um die Verpflanzung von der Mutter auf die Tochter. Es war die erste Operation dieser Art und die Planung dauerte knapp drei Jahre. Derzeit werden vor allem ethische Bedenken diskutiert. Ethische Bedenken und Risiken Grundsätzlich sind an der Transplantation nicht nur die […]
Das Prämenstruelle Syndrom (kurz: PMS) betrifft 30 bis 50 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter. Einige Tage vor dem Einsetzen der Monatsblutung kommt es zu einem komplexen Beschwerdebild, das nicht nur von Frau zu Frau unterschiedlich sein kann, sondern auch von Mal zu Mal variiert. Am häufigsten und schwersten treten die Beschwerden bei Frauen um […]
In Deutschland genießen werdende Mütter ein paar Privilegien, um die sie ihre Schwestern in anderen Ländern beneiden könnten. Denn Sie werden durch die im Gesundheitssystem integrierte Maßnahme der Schwangerschaftsvorsorge auf dem gesamten Weg der Schwangerschaft, Geburt und auch noch nach der Geburt mit bestem medizinischen Know How untersucht und beraten. Der „Mutterpass“ füllt sich so […]
Auch wenn es ein schwacher Trost ist: Übelkeit in der Schwangerschaft verschwindet meistens nach den ersten drei Monaten. Diese müssen aber erst einmal durchgestanden werden und damit das leichter fällt, gibt es anschließend ein paar Tipps. Zunächst aber soll darauf hingewiesen werden, dass bei starkem Erbrechen während der Schwangerschaft (Hyperemesis Gravidarum) unbedingt ein Arzt aufgesucht […]
Wechseljahre verlangen oft nach Hilfe. Temperaturschwankungen, schlechte Gemütsverfassung und noch einiges mehr hängen mit dieser Phase des Lebens zusammen. Häufig werden Hormone eingesetzt, um die Menopause zu überstehen. Die Schulmedizin greift daher immer wieder auf chemische Mittel zurück. Es gibt aber auch eine natürliche Möglichkeit, die Naturheilkunde, um in den Wechseljahren Hilfe zu erhalten und […]