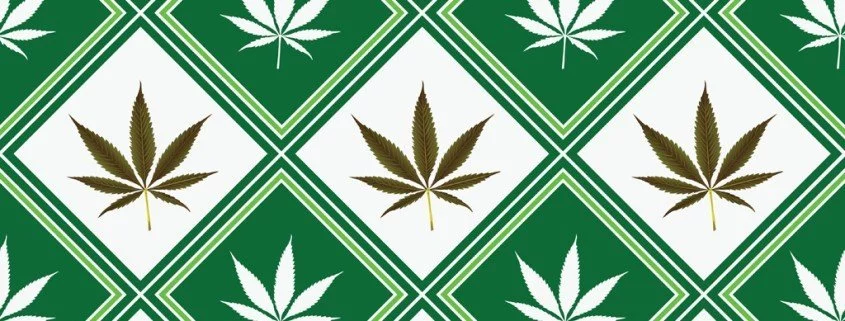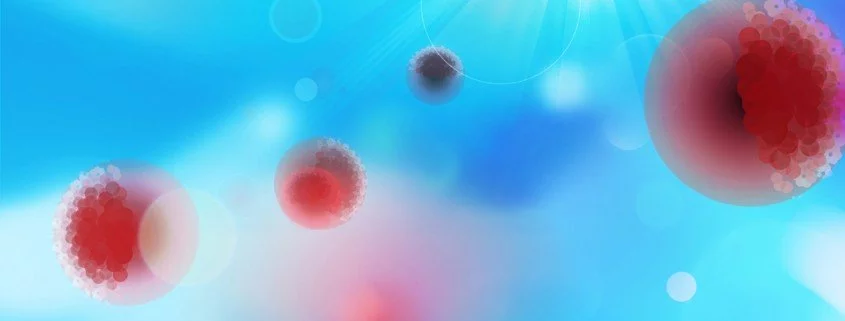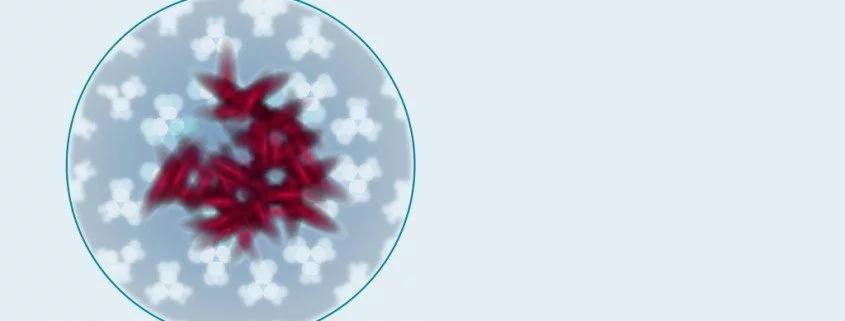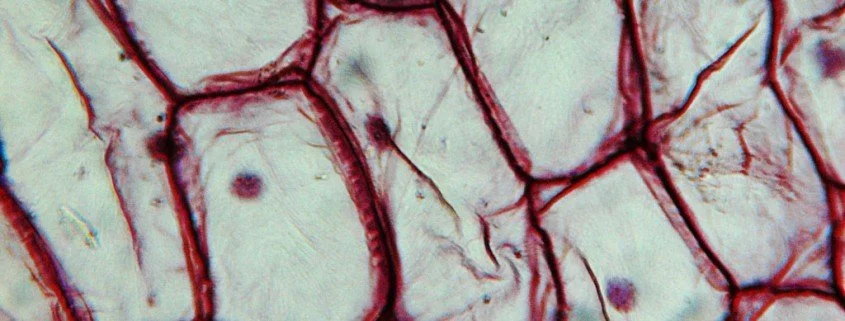In der heutigen Leistungsgesellschaft ist es wichtig, dass alle Menschen funktionieren und möglichst viel Leistung bringen. Auch von den Kindern wird das von Anfang an gefordert. Was aber wenn sich ein Kind nicht schnell genug entwickelt? Leidet es an einer Entwicklungsverzögerung und muss therapiert werden? Viele Erwachsene sehen Therapiebedarf wo keiner ist. Dr. med. Michael […]
Archiv für die Kategorie: Therapie & Verfahren
Du bist hier: Home » Therapie & Verfahren » Seite 7
Gesundheit Therapie & Verfahren
Der Konsum von Marihuana verursacht bei vielen Menschen ein Hungergefühl, das in wahren Fressorgien enden kann. So wird nach dem Genuss eines Joints oftmals eine Pizza bestellt oder die Vorräte geplündert. Das Maß wird dabei schnell außer Acht gelassen. Vor einer Tafel Schokolade wird ebenso wenig Halt gemacht wie vor besagter Pizza mit extra viel […]
Immer mehr Menschen, vor allem Kinder, leiden an der Krankheit ADHS. Aktuell wurde bei 259.000 Kindern ADHS diagnostiziert. Viele Ärzte verordnen dann Medikamente wie Ritalin. Seit Jahren werden dagegen Stimmen laut, die von einer medikamentösen Therapieform abraten und Nebenwirkungen dieser Behandlungsform anprangern. Zudem setze diese Therapieform lediglich bei den Symptomen, aber nicht bei den Ursachen […]
Die Nieren übernehmen eine ganz wichtige Aufgabe für unseren menschlichen Organismus: sie filtern die Schadstoffe heraus. Versagt die Leistung der Nieren langsam, dann wird das relativ schnell durch eine zunehmend ungesunde Hautfarbe deutlich, die anzeigt, dass der Körper langsam vergiftet. Aus diesem Grund ist dieses Organ wichtiger als wir uns vielleicht eingestehen wollen. Versagen die […]
In den vergangenen drei Jahren haben Experten einen „sehr auffälligen“ und vor allem beunruhigenden Anstieg von Syphilis-Neuinfektionen in nahezu allen Industrieländern verzeichnen müssen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte in seinem Infektionsepidemiologischen Jahrbuch die aktuellen Zahlen und versuchte, die Ergebnisse zu deuten. Was genau ist Syphilis, wie kann man sich anstecken und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Syphilis ist […]
Neben Herz-Kreislauferkrankungen ist Krebs die zweithäufigste Todesursache. Jährlich kommen in Deutschland etwa 350.000 neue Fälle dazu. Gut die Hälfte ist nicht therapierbar. Häufig haben sich bereits Metastasen, also Tochtergeschwüre, gebildet. Aber auch ein bedeutender Teil der Patienten ohne Metastasen kann aus verschiedenen Gründen nicht mit Chemotherapie oder konventioneller Bestrahlung behandelt werden. Ein Grund kann beispielsweise sein, […]
War es früher nicht möglich, eine Erblindung zu heilen, so wurden im Laufe der Zeit Verfahren entwickelt, die eine Erblindung zu heilen versprechen. Nun hoffen Forscher, mit der Möglichkeit der Lagerung und des Transports von Stammzellen einen großen Schritt bei der Behandlung der Limbus-Stammzelleninsuffizienz erzielt zu haben. Ursachen einer Limbus-Stammzelleninsuffizienz Als Risikofaktor für die Limbus-Stammzelleninsuffizienz gilt eine übermäßige UV-Strahlung. […]
Kennen Sie das? Rasende Kopfschmerzen, meist einseitig, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit. Selbst Flüstern hört sich an, als würde Sie jemand mit dem Megafon anschreien? Dann gehören Sie vermutlich zu den zehn Prozent der Deutschen, die unter Migräne leiden. Was versteht man unter Migräne? Wie gesagt – mindestens jeder zehnte Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Migräne. […]
Rückenschmerzen sind in Deutschland eine Volkskrankheit: 85 Prozent der Deutschen leiden zumindest einmal in ihrem Leben an Rückenschmerzen. Aber eine Operation ist trotz Bandscheibenvorfall nicht unbedingt die richtige Lösung, sagt der Wirbelsäulenspezialist Dr. Martin Marianowicz. Im ersten Teil seines Interviews mit Vistano erklärt er woran das liegt. Vistano: In keinem anderen Land Europas wird so […]
Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie stehen heute bei vielen Kindern an der Tagesordnung. Der Kinder und Jugendarzt Dr. Michael Hauch begann seinen medizinischen Werdegang mit einem Studium an der Kinderklinik der Universität Düsseldorf, um danach in New York auf einer Kinderkrebsstation weitere praktische Erfahrungen zu sammeln. Als einer der ersten niedergelassenen Kinderärzte in Düsseldorf bietet er […]