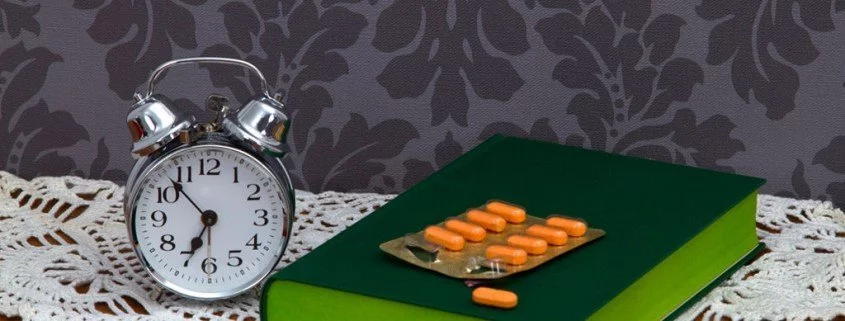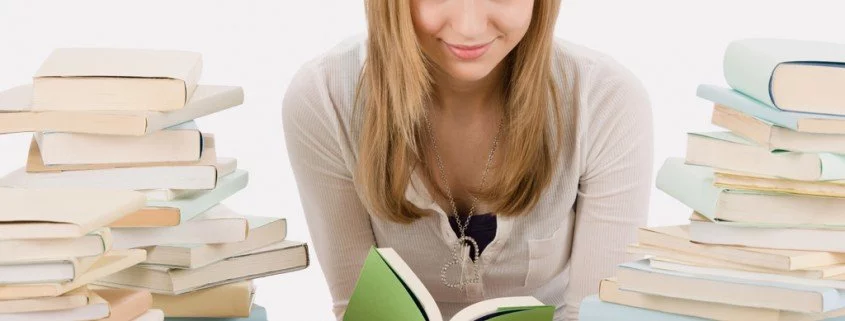Erschreckend hoch ist die Zahl derer, die ohne Beruhigungs- oder Schlafmittel nicht mehr leben können. Schätzungsweise 1 Millionen Menschen in Deustchland sind Schlafmittelsüchtig. Ein Pilotprojekt nimmt sich nun dieser Tatsache an und erarbeitet die Bedeutung der Warnung von Seiten der Ärzte und Apotheke vor den Folgen einer Schlafmittelsucht. Die Schlafmittelsucht ist ein Symptom unserer neuzeitlichen […]
Archiv für die Kategorie: Forschung & Wissenschaft
Du bist hier: Home » Forschung & Wissenschaft » Seite 14
Gesundheit Forschung & Wissenschaft
Sport gilt in Bezug auf so gut wie jede Krankheit als ein Garant für Gesundheit und Schutzfaktor vor Erkrankungen. Auch für Brustkrebs galt dies bis jetzt. Neue Studien zeigen jedoch, dass moderierende Faktoren wie der Hormonspiegel diesen Vorteil zu Nichte machen kann. Sport und Studien In einem vor kurzem veröffentlichten Artikel wurde Sport in hohem […]
Sie wird immer lauter: Die Kritik an der HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Aufmerksamkeitserregend ist zudem die Broschüre der Techniker Krankenkassen und der Barmer GEK über die Therapie bei Gebärmutterhalskrebs. Die Krankenkassen stellen Yoga und weitere naturheilkundliche Therapieformen als Alternativen zur Operation gegen die Bildung von Gebärmutterhalskrebs vor und sorgen bei Ärzten für Empörung und eine offizielle Beschwerde. Jährlich […]
Dass nicht jedes Gesundheitssystem so geregelt funktioniert wie das deutsche, ist hinlänglich bekannt. Leider kann sich daher nicht jeder Mensch die für ihn lebensnotwendigen Operationen leisten. Auch einige Forschungsprojekte können aus Geldmangel nicht realisiert werden. Ein neues Phänomen steht finanziellen Engpässen hinsichtlich medizinischer Behandlungen entgegen. Crowdfunding bezeichnet das gemeinsame Sammeln von Spenden für medizinische Projekte. Watsi, Healfundr […]
Viele Menschen fragen sich, wieso und wodurch Krebszellen entstehen. Eine neue Studie hat nun ergeben, dass folgende Chemikalien die Tumorbildung bei Brustkrebs beeinflussen. Erschreckend ist, dass diese Chemikalien zumeist im Alltag vorkommen und somit täglich konsumiert werden. Eine Vermeidung dieser Substanzen kann das Krebsrisiko entscheidend vermindern, nehmen US-Forscher an. Der Fahrplan zur Vermeidung von Krebs In der […]
Im eigenen Körper gefangen – das ist das Trauma vieler Patienten, die nicht wirklich im Koma lagen, aber so behandelt wurden als ob. Es kann nach operativen Eingriffen im Zentralnervensystem dazu kommen, dass Menschen entweder im Koma liegen oder ihre Bewegungs- und Ausdrucksfähigkeit nur partiell beeinträchtigt ist – bis hin zur Lähmung. Diese Differenzierung ist […]
Kommt irgendwo ein Kind auf die Welt, rätseln Eltern und Angehörige meist sofort, wem es am Ähnlichsten sieht. In der Regel spiegeln sich die Gesichtszüge beider Elternteile in dem kleinen Wesen wider. Aber wie kommt es, dass man bestimmte Prägungen schon so früh erkennen kann? Welche Gene sind es, die letztendlich bestimmen, wie wir aussehen und welchen […]
Erst vor Kurzem haben die bahnbrechenden Forschungsergebnisse des Teams um den amerikanischen Zellbiologen Dr. Shoukhrat Mitalipov von der Oregon Health & Science University für Furore gesorgt: Die Forscher hatten die letzte biochemische Hürde genommen und das Klonen von menschlichen Embryonen möglich gemacht. Auch heute enthalten die Neuigkeiten ethischen Zündstoff: Eine neue Befruchtungsmethode soll die mitochondriale […]
Wie könnte eine erfolgreiche Tinnitus-Therapie aussehen? Ein Segen, wer das folgende Thema nicht aus eigener Erfahrung, sondern lediglich vom Hörensagen kennt. Rund zehn bis 15 Prozent der Deutschen haben länger anhaltende Ohrgeräusche, mit denen sie ihren Alltag jedoch problemlos meistern können. Sie verspüren weder eine emotionale noch leistungsmäßige Minderung ihres Potentials. Doch dann gibt es […]
Was wäre es schön, wenn das Lernen im Schlaf doch Realität würde. Hierbei steht vor allem der Wissenszuwachs im Vordergrund, der sich im Langzeitgedächtnis gesetzt hat. Noch testen Wissenschaftler unter welchen Bedingungen das Lernen am effektivsten ist. Verschiedene Medikamente und Möglichkeiten gibt es bereits. So wird Ritalin nicht nur von Kindern, die an ADHS erkrankten, […]