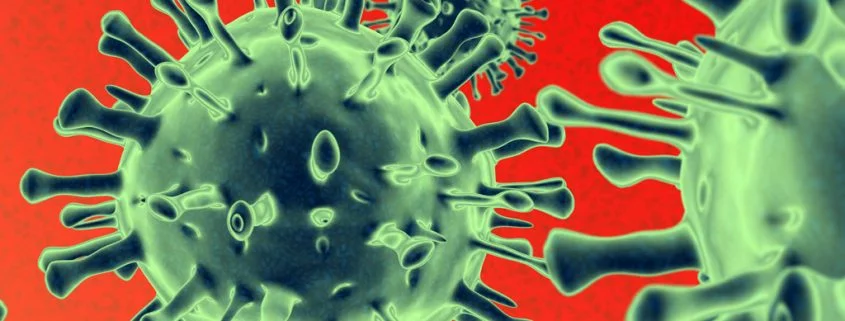Schwerkranken kann oft mit herkömmlichen Medikamenten nicht weitergeholfen werden. Für sie gibt es aber nun eine neue Hoffnung: Der Weg zu bislang nicht-zugelassenen Medikamenten ist nicht so beschwerlich wie angenommen. Informationsportale ermöglichen eine gute Beratung, wenn es um Medikamente geht, die im Ausland bereits zugelassen sind oder sich zumindest in der Testphase befinden. Auch die […]
Archiv für die Kategorie: News & Storys
Du bist hier: Home » News & Storys » Seite 9
Gesundheit News & Storys
Dieser Tage ist die WM in aller Munde und in nahezu jedem Wohnzimmer Deutschlands zu finden. Manche bestaunen lediglich die Deutschlandspiele und wieder andere sehen sich auch die möglichen Konkurrenten und ihre Spiele an. Besonders diese WM gab schon so manchem Grund sich überschwänglich zu freuen oder auch die eigene Mannschaft zu verfluchen. Dabei kochen […]
In der Nacht zum Dienstag kam der erste Ebola-Fall in Europa zu Tage: Eine spanische Krankenschwester, die zuvor an Ebola erkrankte Patienten gepflegt hatte, wurde umgehend in eine Madrider Spezialklinik eingeliefert. Zuvor hatten zwei Tests ein positives Resultat ergeben. Die Frau schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörden in Madrid mitteilte. Erste […]
Sogenannte E-Shishas sind nichts weiter als nikotinfreie Einwegzigaretten. Sie sollen die „gesunde“ Alternative zur nikotinhaltigen Zigarette darstellen. Mit Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen, Cola oder Schokolade locken sie aber auch jene Jugendliche an, die zuvor keinen Gefallen am Rauchen selbst gefunden haben. Wie gefährlich sind E-Shishas? E-Shishas enthalten zunächst einmal kein Nikotin, was sich nur positiv auf […]
Der Konsum von Cannabis ist seit einigen Monaten DAS Gesundheitsthema schlechthin. Ist Cannabis als Droge oder Schmerzmittel zu sehen? Sollte privater Cannabis-Konsum legalisiert werden? Eine australische Studie untersuchte jüngst den Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und Cannabis-Konsum sowie Suizidrisiko. Schulabschluss und Cannabis-Konsum Forscher aus Australien und Neuseeland haben den langfristigen Cannabis-Konsum von Jugendlichen unter die Lupe genommen. […]
Eigentlich ist die Beulenpest ein Mythos aus Geschichtsbüchern, aber nun scheint die bakterielle Infektion wieder zurück zu sein. Im Westen der Volksrepublik China gab es nun einen Todesfall durch die Beulenpest. Im Mittelalter löste Yersinia pestis, ein Bakterium, eine Katastrophe aus. In Europa fielen der Beulenpest ein Drittel der Menschen zum Opfer. Es gab die […]
Lässt sich das Leben noch in seiner ganzen Fülle genießen, wenn einen selbst zahlreiche Gebrechen plagen? Immer mehr Menschen klagen über chronische Erkrankungen, angefangen bei Diabetes über chronische Schmerzen im Rückenbereich bis hin zu Depressionen. Doch was können wir tun, um unsere Gesundheit bestmöglich zu erhalten und bis ins hohe Alter fit zu bleiben? Ein […]
Eines ist ja mal ganz klar: Schumacher hält seine Schutzengel schon seit Jahrzehnten ganz schön auf Trab. Da waren beispielsweise die vielen Unfälle aus seiner Zeit als Kartfahrer und Formel-1-Rekordweltmeister. Sein schwerer Motorradunfall vor knapp fünf Jahren hat uns ebenfalls die Luft anhalten lassen. Jetzt, nach seinem Skiunfall in den französischen Alpen, hofft die ganze […]
Die Politik fordert und fördert den Wettbewerb im Gesundheitswesen. Ein erklärtes Ziel der Gesundheitspolitik ist es, die Zahl der Krankenkassen durch den Wettbewerb um Mitglieder und Versicherte zu reduzieren. Aber wie viele Krankenkassen sollte es geben? Und wie viele Krankenkassen muss es geben? Die Zahl der Krankenkassen in Deutschland ist rapide gesunken 1970 existierten in […]
Ein Gläschen Wein mit Freunden oder ein Feierabendbier auf dem Balkon – meist fällt es uns schwer, auf Alkohol zu verzichten. Doch was bringt es uns wirklich, für ein paar Wochen oder sogar Monate eine Alkoholpause einzulegen? Durch Abstinenz die Leber erholen Experten betonen immer wieder, dass selbst geringe Mengen Alkohol unserer Leber ernsthaften Schaden […]