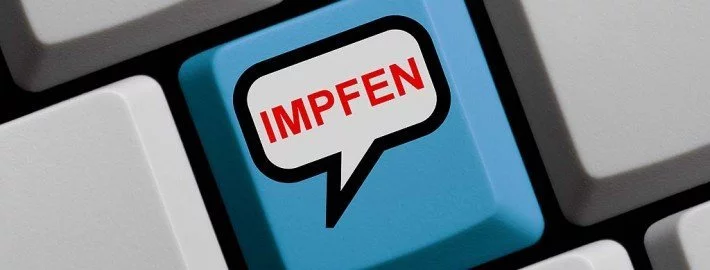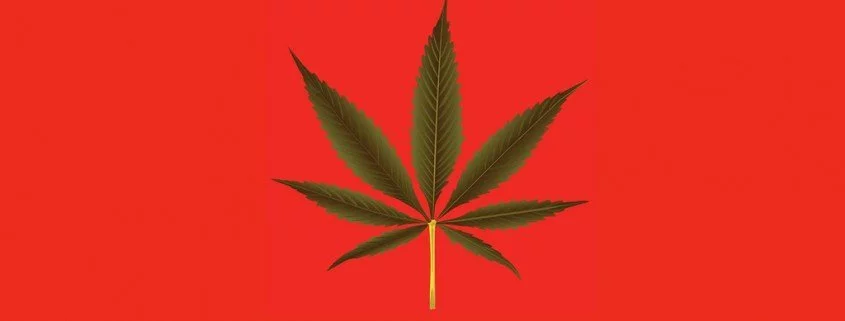Die Grippe Saison hat begonnen. Wie in jedem Jahr wollen sich auch in diesem Jahr wieder unzählige Menschen impfen lassen. Dies könnte für viele allerdings zum Problem werden. Obwohl 16 unterschiedliche Impfstoffe zur Verfügung stehen, kommt es zu regionalen Engpässen. Kritik an Novartis Vor allem die Politik streitet derzeit, wer die Schuld an den fehlenden […]
Archiv für die Kategorie: Forschung & Wissenschaft
Du bist hier: Home » Forschung & Wissenschaft » Seite 16
Gesundheit Forschung & Wissenschaft
Bluthochdruck ist ein weit verbreites Phänomen. Nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Bluthochdruck auch Probleme bei der Erkennung von Emotionen bei anderen Personen bereitet. Studie belegt Problematik Die Studie der amerikanischen Clemson University zeigt deutlich, dass hoher Blutdruck dazu führt, dass die Gefühle anderer Menschen nur noch eingeschränkt wahrgenommen werden. Dieser Umstand bezieht sich nach den […]
Cannabis ist eine der am weitesten verbreiteten Drogen. Sie gilt unter Konsumenten als harmlos und auch viele Nicht-Konsumenten stufen sie als verträglich ein. Dennoch: Psychosen, die durch Drogen ausgelöst werden, sind in diesem Zusammenhang weit häufiger zu finden, als allgemein bekannt ist. Dies gilt nicht nur für die harten Drogen. Auch das relativ “weiche Cannabis” […]
Das heutige Fundstück unserer Vistano Gesundheitsredaktion ist das neue Gadget von Dr. David Albert. Mit seinem AliveCor iPhonECG entwickelt Dr. Albert ein mobiles Elektrokardiogramm für iPhone und iPad. Die aufsetzbare Hülle mit Kontaktelektroden in Kombination mit der EKG App sollen das iPhone zum Heim-EKG umfunktionieren um Risikopatienten die Möglichkeit zu geben ihre Heizströme selbst zu […]
Können Menschen mit Querschnittslähmung wieder Hoffnung fassen? Wissenschaftler der Universität Louisville (Kentucky, USA) arbeiten aktuell an einem Experiment, das aufhorchen lässt. Mit Hilfe von elektrischen Impulsen können bestimmte Muskelpartien aktiviert werden, die dem Grunde nach von der Querschnittslähmung betroffen sind. Bei den Impulsgebern handelt es sich um 16 Elektroden, die dem Patienten ans Rückenmark gesetzt werden. […]
Was ist die Epigenik? Jeder Mensch hat einen genetischen Code. Die Entscheidung, wie ein Mensch “tickt”, ist allerdings von mehr Kriterien abhängig, die ebenfalls im genetischen Gefüge zu finden sind. So gibt es neben den vier priorisierten Bausteinen für die DNS auch so genannte Epigenik, epigenetische dynamische Codes, welche in erster Linie dafür verantwortlich sind, […]