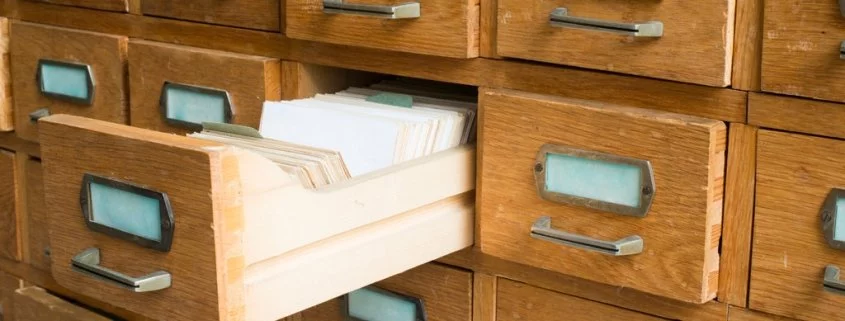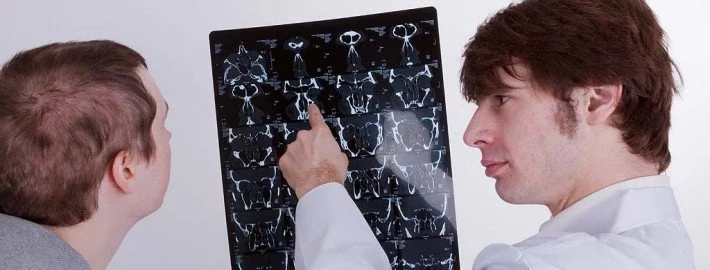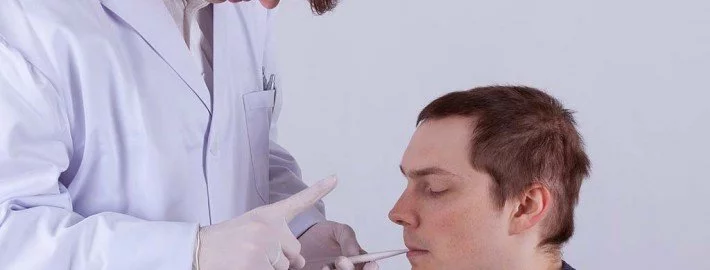In den ersten beiden Teilen über Naturheilkunde und Krebserkrankungen haben wir uns damit beschäftigt, wann sie sinnvoll zum Einsatz kommt und wie wichtig die Ernährung und Bewegung ist. In diesem letzten Beitrag setzen wir uns nun mit der Substituierung auseinander. Das Spurenelement Selen bei Krebserkrankungen Das Spurenelement Selen kann von Körper nicht selber hergestellt werden, […]
Beiträge
In Deutschland erkranken jährlich ca. 500.000 Menschen an einer Krebserkrankung. Die Entwicklung der Erkrankung stellt die Gesellschaft vor eine große Herausforderung. Nun startet „Nationale Dekade gegen Krebs“ als gemeinsame Initiative. Vertreter aus der Krebsforschung, des Gesundheitswesens und der Politik sind in der Initiative vertreten. Krebs ist die am meisten gefürchtete Krankheit und leider auch die […]
Forscher um Nongluk Plongthongkum von der Universität of California in San Diego entwickeln ein Verfahren, um die Körperstellen zu ermitteln, an denen Tumore sitzen. Dafür wird lediglich eine Blutprobe des Patienten benötigt, aus der dann die DNA-Spuren gefischt werden. Mithilfe von gewebetypischen Markern kann dann der Ort des Tumors herausgefunden werden. Auch bei der Identifizierung von Metastasen […]
Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 60.000 Männer an Prostatakrebs. Häufig wird diese Erkrankung jedoch viel zu spät erkannt, da viele Männer den Gang zum Arzt scheuen, aus Angst, es könnte etwas Schlimmes diagnostiziert werden. Dabei wird eine Früherkennung von den Ärzten bereits ab einem Alter von 45 Jahren empfohlen. Viele Menschen denken schlichtweg „Das wird mir […]
Der Super-GAU in Fukushima und generell die Gefährlichkeit, die mit der Arbeit und dem Leben im Bereich von Atomkraftwerken einhergeht, lässt die Bevölkerung vorsichtig handeln. Nun bestätigt eine Studie, was die große Angst einiger Bürger war: Es gibt einen Zusammenhang zwischen hoher radioaktiver Strahlung und lebensgefährlichen Krankheiten. Bei einem früheren Angestellten aus Fukushima wurde nun […]
In der Weltpresse geht derzeit eine traurige Nachricht um: Die US-Sängerin Anastacia ist zum zweiten Mal an Brustkrebs erkrankt. Bei der 44-jährigen war im Jahre 2003 das erste Mal Brustkrebs diagnostiziert worden und sie hatte den Krebs besiegt. Nun sieht sie sich gezwungen, den Kampf gegen den Krebs noch einmal aufzunehmen. Tausende von Frauen, die […]
Niemand mag gern zum Zahnarzt gehen. Es ist kein Geheimnis, dass man sich unangenehme Behandlungen durchaus ersparen kann, wenn man Wert auf eine gute Mundhygiene legt. Nun aber zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass häufiges und gründliches Zähneputzen durchaus noch andere positive Wirkungen hat. Die „Apotheken-Umschau“ berichtet, dass in Japan bei einer Untersuchung an 856 Krebspatienten und 2696 Kontrollpersonen […]
Krebspatienten fallen mit der Diagnose oftmals in ein schwarzes Loch, das ihnen den Boden unter den Füßen zu entreissen scheint. Die Diagnose Krebs geht in vielen Fällen mit einer begleitenden Chemotherapie einher. Haarausfall, ständige Übelkeit, Unwohlsein und viele weitere Symptome werden zum schrecklichen Alltag für die Erkrankten. Oftmals fühlen sich die Betroffenen antrieblos, geschwächt und schlapp. Sport […]
Der Moment, in dem der Arzt einem Patienten mitteilt, dass die Diagnose „Krebs“ lautet dürfte einer der dramatischsten und subjektiv empfunden lebensbedrohlichsten Augenblicke überhaupt sein. Doch Krebs ist eben nicht gleich Krebs und im Gegensatz zu dieser subjektiven Empfindung bei Weitem nicht immer tödlich. Ein US-amerikanisches Ärzteteam vom US-National Cancer Institute fordert deshalb die Neukategorisierung […]
Laut einer Studie der Universität Oxford, die auch in der Fachzeitschrift Genome Research zu finden ist, führt der Vitamin-D-Mangel zu unangenehmen Nebeneffekten, wie Krebs und Autoimmunkrankheiten. Ausreichende Mengen an Vitamin D seien jedoch für Genrezeptoren wichtig, um den Ausbruch solcher Krankheiten verhindern zu können. Kommt es im Körper zu einem Vitamin-D-Mangel, kann dies über längere […]