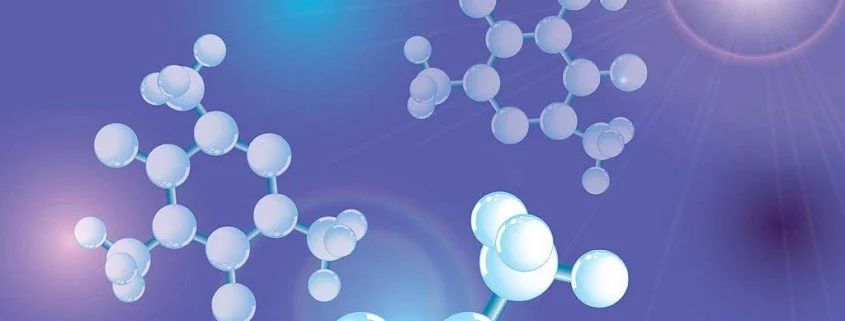Das Bostoner Kinderkrankenhaus hat erstmals Mikropartikel erzeugt, die direkt in die Blutbahn injiziert werden können. Es handelt sich dabei um Sauerstoff, der die Versorgung sicherstellt, auch wenn der Patient selbst nicht mehr atmen kann. Damit gelang den Medizinern ein wichtiger Durchbruch in der Notfallmedizin, denn diese Technik ermöglicht die Rettung von Millionen Patienten, die aufgrund […]
Schlagwortarchiv für: Erste Hilfe
Du bist hier: Home » Erste Hilfe » Seite 2
Beiträge
In den Debatten um die Herausforderungen im deutschen Gesundheitswesen rückt seit geraumer Zeit der Ärztemangel vermehrt in den Fokus. Während die einen von einem Ärztemangel insgesamt ausgehen, betonen die anderen, dass es in Deutschland insgesamt genug Ärzte gibt. Das Problem sei vielmehr eine ungleiche Verteilung der Ärzte zwischen urbanen und ländlichen Regionen. Unbestritten gilt: Ländlichen […]
Ein Schlaganfall trifft einen Menschen meist unvorbereitet und plötzlich. Das Leben danach ist anders als vorher. Nichts ist mehr, wie es war. Den Alltag wieder bewältigen zu können ist eine große Aufgabe. Was passiert bei einem Schlaganfall? Ein Schlaganfall passiert dann, wenn sich die Versorgung des Gehirns mit Blut verringert oder ganz wegfällt. Gründe hierfür […]
Viele Menschen haben beim Baden im Mittelmeer Angst vor Quallen. Zwar sind die Quallenarten, welche im Mittelmeer vorkommen, nicht bedrohlich oder lebensgefährlich, dennoch kann ein Zusammenstoß mit einer Qualle unangenehme Folgen mit sich bringen. Meist wird die betroffene Hautstelle rot und es bilden sich kleine Blasen. Nicht selten brennen die betroffenen Stellen noch einige Stunden […]
Schlaganfälle sind eine einschneidende Erfahrung für den Betroffenen und seine Angehörigen. Während eines Schlaganfalls wird eine Stelle des Gehirns nicht richtig durchblutet. Meist ist eine Ader, durch die das Blut im Bereich des Gehirns fließt, schon längere Zeit verengt und es hat sich an dieser Verengung ein Blutgerinnsel gebildet. Ist es erstmal so weit, sterben […]
Die meisten schmerzgeplagten Menschen möchten diesen Zustand so schnell wie möglich beenden. Neben Schmerztabletten und Salben zum Einreiben greifen viele Betroffenen daher auf Kälte oder Wärme zurück, um die Schmerzen dadurch zu lindern. Aber wer weiß schon immer ganz genau, welches von den Beiden im jeweiligen Fall anzuraten ist oder vielleicht sogar völlig falsch sein […]
Die meisten kennen das Phänomen des Seitenstechens schon vom Schulsport. Man läuft und schon nach kurzer Zeit beginnt eine Seite unangenehm zu ziehen und zu stechen. Die Ursache für das lästige Seitenstechen ist noch nicht entdeckt worden. Es gibt jedoch ein paar Theorien, wie es überhaupt zum Seitenstechen kommen kann. Die meisten Experten gehen davon aus, dass […]
Auch wenn effektive Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden, kann es gerade im Hochsommer schnell passieren, dass man sich einen Sonnenbrand zuzieht. Wenn die Haut sichtlich verbrannt ist, dann birgt dies nicht nur gesundheitliche Gefahren, es tut auch sehr weh und daher ist Linderung auch enorm wichtig. Sollte der Sonnenbrand besonders stark ausfallen, dann ist ein Besuch beim […]
Jeder kennt es: Eine kleine Unachtsamkeit und schon hat man sich beim Kartoffeln schälen in den Finger geschnitten oder ist bei einem allzu ambitionierten Sprung auf der Nase gelandet und hat sich das Knie aufgeratscht. Alles halb so wild, sagt auch Ernst Tabori, ärztlicher Direktor des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene in Freiburg. Der Experte gibt […]
Prellungen Stürze, Tritte oder Schläge sind die häufigsten Ursachen für eine Prellung. Dabei wird der Muskel gegen den Knochen gedrückt. Blut- und Lymphgefäße werden dabei beschädigt und die Stelle schwillt an. Häufig bildet sich dann auch ein Bluterguss. Bei einer Prellung ist meist keine Behandlung notwendig. Zerrungen Wird der Muskel überdehnt und zieht sich dann […]