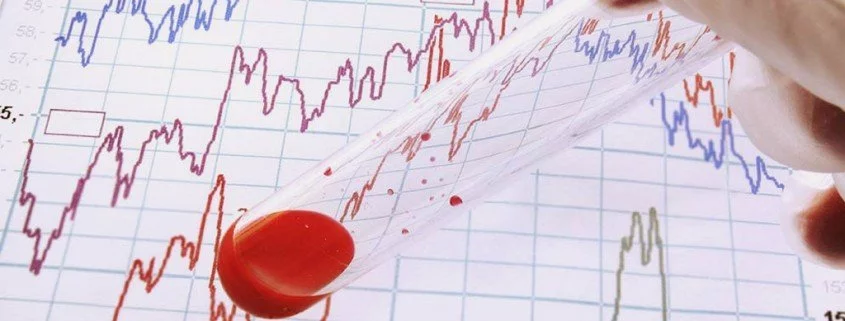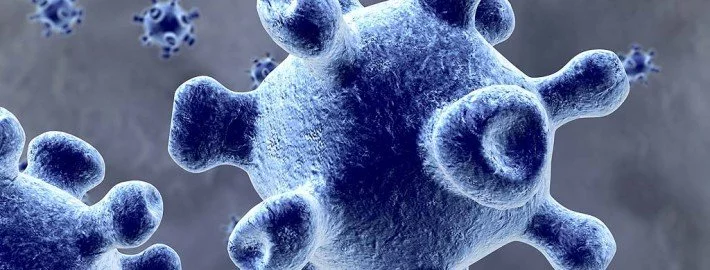Was ist die Epigenik? Jeder Mensch hat einen genetischen Code. Die Entscheidung, wie ein Mensch “tickt”, ist allerdings von mehr Kriterien abhängig, die ebenfalls im genetischen Gefüge zu finden sind. So gibt es neben den vier priorisierten Bausteinen für die DNS auch so genannte Epigenik, epigenetische dynamische Codes, welche in erster Linie dafür verantwortlich sind, […]
Schlagwortarchiv für: Genetik
Du bist hier: Home » Genetik
Beiträge
Durch verschiedene Studien konnte nachgewiesen werden, dass unser Körperbau zwischen 50 und 70 Prozent von unserer DNA abhängt. Es wurden beispielsweise eineiige Zwillinge direkt nach der Geburt in verschiedene Familien gegeben. Trotzdem zeigten sie später auffallende Gemeinsamkeiten bei ihrem Gewicht und ihrer Körperform. DNA und das Hormon Leptin Das Hormon Leptin ist für unser Sättigungsgefühl […]
Auch in diesem Jahr werden wieder die Nobelpreise verliehen. Den Auftakt bilden dabei jährlich die Medizin Nobelpreise, gefolgt von Physik, Chemie, Literatur und dem Friedensnobelpreis. Gerade der diesjährige Nobelpreis in Medizin würdigt dabei eine zukunftsträchtige Technologie. Ausgezeichnet werden der Brite John Gurdon sowie der Japaner Shinya Yamanaka, die auf dem Gebiet der Stammzellenforschung arbeiten. Die […]
Magenkrebs ist eine der aggressivsten Krebsarten überhaupt. An dritter Stelle der Krebs-Todesursachen steht die Magengeschwulst. Jedes Jahr sterben weltweilt 700.000 Menschen an Magenkrebs und trotzdem gibt es bislang lediglich eine einheitliche Therapie, um diesem Leiden beizukommen. Forscher fordern spezifischere Behandlungsmöglichkeiten, um jeder individuellen Krebsform begegnen zu können. Magenkrebs tritt nämlich in ganz unterschiedlichen Formen auf, […]
Tuberkulose, kurz „TBC“ genannt, ist eine stark infektiöse Erkrankung der Atemwege. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben an Tuberkulose weltweit noch immer Millionen Menschen pro Jahr. Und auch für Deutschland weist die Statistik des Robert-Koch-Instituts für 2012 noch über 4.000 Sterbefälle in Folge einer TBC-Infektion aus. Mit dem Verschwinden der großen Tuberkulose-Epidemien ist bei uns […]
Gehörst Du auch zu den Schmerzgeplagten? Kopf- oder Rückenschmerzen? Stelle Dir mal vor, Du könntest keinen Schmerz empfinden. Das klingt zunächst mal toll. Aber will man das wirklich? Schmerz ist ja eigentlich ein relevantes Signal zum Schutz vor Verletzungen. Du hast sicher auch schon von Menschen gelesen, die ein vermindertes Schmerzempfinden haben und sich infolgedessen häufig […]
Erst vor Kurzem haben die bahnbrechenden Forschungsergebnisse des Teams um den amerikanischen Zellbiologen Dr. Shoukhrat Mitalipov von der Oregon Health & Science University für Furore gesorgt: Die Forscher hatten die letzte biochemische Hürde genommen und das Klonen von menschlichen Embryonen möglich gemacht. Auch heute enthalten die Neuigkeiten ethischen Zündstoff: Eine neue Befruchtungsmethode soll die mitochondriale […]