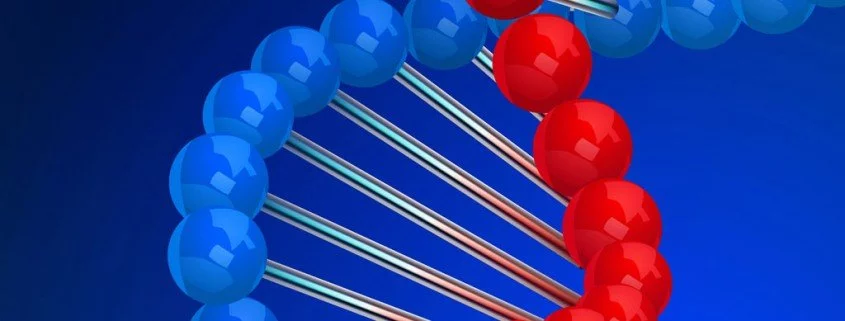Ein Antibiotikum gegen Atemwegsinfektionen und Blasenentzündung, sowie das Spiel Tetris sollen Opfer von posttraumatischen Belastungsstörungen helfen, die schrecklichen Erlebnisse besser verarbeiten zu können. Nach schlimmen Ereignissen leiden viele Menschen oft unter posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), die sie den Unfall, die Vergewaltigung oder den Bombenangriff immer und immer wieder erleben lassen. Sie leiden psychisch stark darunter. Doch […]
Archiv für die Kategorie: Traumata
Du bist hier: Home » Traumata
Psychologie – Traumata
Sein Leben für andere geben. Was steckt hinter einer solchen Bereitschaft? Ein wichtiger Faktor ist das gemeinsame Erleben schrecklicher Erfahrungen, was die Beteiligten, auch nicht verwandte Menschen, zusammenschweißen lässt. Menschen sind soziale Wesen. Einer Gruppe anzugehören hat sich schnell als überlebenswichtig erwiesen. Auch das kooperative Verhalten innerhalb der Verwandtschaft und der Gruppe zeigte sich im Laufe […]
Was kannst Du tun, um Trauma-Patienten und ihren Angehörigen nach einem Schicksalsschlag wieder zurück ins Leben zu helfen? Alena Mehlau ist Therapeutin und sie gibt Tipps, die Dir dabei sehr hilfreich sein können. Menschen können durch Zufälle, Unfälle oder auch Naturkatastrophen vor schwierige Aufgaben gestellt werden. Sie erfahren am eigenen Leib, wie es ist, so etwas […]
Anhand von Tierversuchen ist es Forschern der Universität und der ETH Zürich gelungen zu zeigen, dass Traumata vererbt werden können. Das Gute ist jedoch, dass laut den Forschern Traumata reversibel sind. Können Traumata wirklich vererbt werden? Wer in seiner Kindheit Schweres erlebt hat, hat höhere Chancen auch einmal unter einer psychischen Krankheit zu leiden oder […]
Atomunfälle – In den meisten Fällen stehen die körperlichen Schäden der Opfer wie in Fukushima im Fokus. Dass es aber auch zu schweren psychischen Folgen kommen kann, wird vielfach außer Acht gelassen. Deshalb erachten es Experten als notwendig, dass diese Risiken den Anwohnern von Atomanlagen besser vermittelt und erklärt werden. Atomunfälle Bessere Aufklärung der Bevölkerung Eine […]
An der University of Oxford haben Psychologen Risikofaktoren für die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung nach einem traumatischen Ereignis untersucht. Leichen, lebensgefährliche Unfälle oder Krankheiten – Notfallärzte und Sanitäter sind oft mit belastenden Situationen konfrontiert. Diese Situationen können dazu führen, dass die betroffenen Ärzte und Sanitäter eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln. Psychologen haben untersucht, wo die […]
Nicht nur Menschen die Hilfe brauchen sollte geholfen werden, sondern auch denen die helfen. Flüchtlingshelfer gehören zu diesen Menschen. Sie bekommen von Flüchtlingen schreckliche Geschichten erzählt. Die Flüchtlinge erzählen ihnen, wie sie verfolgt wurden und geflohen sind. Das alles bleibt natürlich nicht ohne Folgen: Auch Helfer brauchen psychologische Hilfe. Nicht selten klagen Helfer selbst über […]
Nicht wenige Soldaten, die aus Einsätzen beispielsweise in Afghanistan in die Heimat zurückkehren, verhalten sich anschließend merkwürdig. Enge Angehörige und Freunde beschreiben häufig, dass die Betroffenen ein komplett neuer Mensch geworden sind. Früher waren sie häufig selbstbewusst und stark, leiden jedoch seit ihrer Rückkehr an extremen Ängsten und sind häufig niedergeschlagen. Manche, die besonders schwere […]
Ein Trauma ist medizinisch gesehen eine Verletzung. In der Psychologie wird unter einem Psychotrauma eine seelische Verletzung infolge einer Erschütterung, die durch ein traumatisierendes Erlebnis hervorgerufen wurde, verstanden. Diese Erschütterung kann beispielsweise ein Unfall, Gewaltanwendung, eine Krankheit oder auch der Tod eines nahestehenden Menschen sein. Der Grad der Verletzung ist individuell verschieden, je nach Sensibilität […]
Die Bundeswehr wurde reformiert und es scheint, als sei dies auf Kosten der Soldaten gegangen. Der Psychologenmangel im Bereich der Nachsorge für Bundeswehrsoldaten ist alarmierend. Es werden immer mehr Probleme beobachtet, die auf Einsatz- oder Dienstprobleme zurückzuführen sind. Hier werden Grenzen nicht nur erreicht, sondern in einigen Fällen sogar überschritten. Die Umstrukturierung der Bundeswehr hat zur Folge, […]
Denkt man an Verkehrsunfälle, denkt man zuerst an die körperlichen Folgen: Schleudertrauma, Schnittwunden, Prellungen und andere Verletzungen bestimmen die Gedanken an einen Verkehrsunfall und seine Folgen. Die seelischen Folgen aber werden häufig übersehen. Nicht selten bleiben Betroffene eines Verkehrsunfalls mit den psychischen Folgen, beispielsweise einem Trauma, alleine und auf sich gestellt. Psychische Folgen eines Verkehrsunfalls […]
Der Begriff des Traumas wird heute viele schneller verwendet, als es noch vor Jahren der Fall war. Es gibt viele Ereignisse, die ein Trauma hervorrufen. Nicht immer muss ein Trauma auch zu einer traumatischen Störung führen. So ist der Umgang mit dem Trauma und der traumatisierten Person ein wichtiger Faktor, um daraus zu entkommen. Ein Trauma kann […]
Wer einem traumatischen Erlebnis ausgesetzt war, bei dem kommt es zu seelischen Verletzungen, die das Leben auf Dauer überschatten können. Viele dieser Menschen geraten dann in einen Isolationszustand oder sind ihren Ängsten hilflos ausgeliefert. Anders als bei einer körperlichen Verletzung sind die Wunden, die ein Trauma hinterlässt, nicht zu sehen. Daher ist es sehr wichtig, die Ursachen […]
In Deutschland leben viele Flüchtlinge und Menschen, die in ihrer Vergangenheit schreckliches Dinge wie Krieg, Verfolgung und Folter durchleben mussten. Laut einer Studie der Universität Konstanz, die in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entstand, leiden 40 Prozent der in Deutschland lebenden Flüchtlinge infolge ihrer grausamen Vergangenheit unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Bei diesem Krankheitsbild entstehen […]
Expositionstherapie auf Basis von virtuellen Realitäten ist die neuste Entwicklung in der Forschung nach effektiven Behandlungsmethoden von psychisch Kriegsversehrten. Die Posttraumatische Belastungsstörung ist mit den Phobien und Angststörungen verwand und hier hilft oft eine Expositionstherapie. Da die das Trauma erzeugenden Situationen meist nicht nachstellbar sind, mag hier die virtuelle Realität Abhilfe schaffen. Neuste Studien weisen den Weg in diese […]
Traumata lassen sich nicht immer schnell und einwandfrei diagnostizieren. Besonders bei Kindern stellt eine traumatische Erfahrung behandelnde Ärzte oftmals vor große Anforderungen. Kinder sprechen nicht immer gerne mit ihren Eltern oder Freunden über traumatische Erlebnisse und meist fällt es ihnen schwer das Erlebte richtig zu erfassen. Stattdessen flüchten sie sich in Traumwelten und erfinden eine […]
Gewalt ist keine Erfahrung, die ausschließlich Frauen machen. Männer werden genauso oft Opfer von häuslicher Gewalt wie Frauen. Häufig halten die Betroffenen still und schweigen. Laut einer aktuellen Studie des Robert-Koch Instituts (RKI) wurden in Berlin fast genauso viele Männer wie Frauen Opfer häuslicher, körperlicher Gewalt. Hierbei wurde festgestellt: Häusliche Gewalt gegen Männer ist noch immer […]
Unter dem Begriff Gestalttherapie versteht man ein psychotherapeutisches Verfahren der Humanistischen Psychologie. Entwickelt haben sie der Psychoanalytiker Fritz Perls, seine Frau Lore Perls und der Soziologe Paul Goodman. Die Bezeichnung Gestalttherapie hat ihren Ursprung in der Gestaltpsychologie. Diese beschäftigt sich damit, wie sich die menschliche Wahrnehmung ihre eigene Wirklichkeit konstruiert. Anders gesagt, wie sich der Mensch seine […]
Das griechische Wort traumen bezeichnet zunächst einmal eine Wunde, die sich im psychologischen Kontext auf die Seele bezieht. Wir alle erfahren im Verlauf unseres Lebens Verwundungen. Situationen, die uns psychisch belasten, kommen häufiger vor. Traumata sind aber lebenslange Wunden, Erschütterungen der Seele, die uns in akuten Stresssituationen wieder in den Moment des auslösenden Erlebnis zurück versetzten. […]
Einige Zahlen Pro Jahr werden in Deutschland etwa 7000 – 8000 Vergewaltigungen bekannt. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. 99% der Täter sind männlich. Die Verjährungsfrist beträgt zwanzig Jahre. Definition Eine Vergewaltigung ist eine Form des sexuellen Missbrauchs. Eine Person wird gegen ihren Willen zum Vollzug des Geschlechtsverkehrs gezwungen. Aber auch andere Formen des sexuellen […]