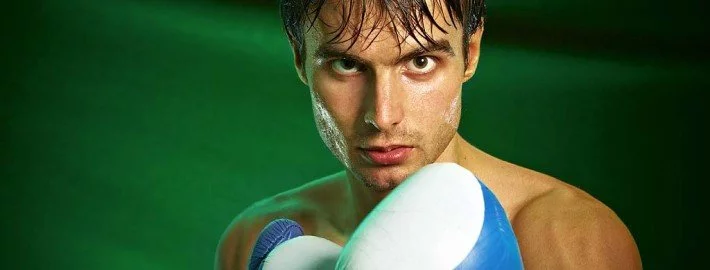Aggression wird immer wieder mit Zerstörung in Verbindung gebracht. Aggression kann aber auch als ein gutartiges Werkzeug fungieren und somit einen Nutzen mit sich bringen. Hierfür gilt, dass sie einfach umgelenkt werden muss, sodass die aufgewendeten Energien genutzt werden, um positive Veränderungen herbeizuführen. Damit kann Aggression, richtig genutzt, auch ein motivierender Faktor sein. Von Entstehung, […]
Schlagwortarchiv für: Wut
Du bist hier: Home » Wut
Beiträge
Aggressionen sind ein Teil des menschlichen Lebens. Das Abbauen der Aggressionen ist daher ein wichtiger Bereich aus diesem Themengebiet und jeder Mensch hat seine eigenen Methoden entwickelt, um Aggressionen abbauen zu können. Einige davon sind effizient, andere eher ungeeignet und können dann sogar dazu führen, dass die Aggressionen falsch ausgelebt werden. Mechanismen der Aggression & […]
Aggressionen bestimmen den Alltag. Beispielsweise helfen sie dem Menschen, sich durchzusetzen. Oft sind die Aggressionen aber zu stark, um sie mit normalen Mitteln abzubauen. Um die Aggressionen dann bewältigen zu können, müssen Verfahren zur Selbstbeherrschung erlernt werden, die das Ausleben verhindern. Zwei Varianten des Aggressionsabbaus Grundsätzlich gibt es zwei Arten, die dazu beitragen, dass Aggressionen […]
Aggression ist eine Emotion, das durch zahlreiche Einflüsse hervorgerufen wird. Diese Einflüsse lösen dann körperliche Vorgänge aus, die als das spürbar werden, was wir als unter dem Begriff Aggression verstehen. Der Herzschlag erhöht sich, der Körper ist auf Kampf ausgerichtet und mit der Aggression kommt es kurzzeitig auch zu Stress. Jeder Mensch kennt die Aggression […]
Manche Emotionen wie Heiterkeit und Freude werden von Menschen besonders hoch geschätzt. Eine Emotion, die allerdings nicht gerne gesehen ist, ist die Wut. Emotionen wie die Wut entstehen in der Amygdala, die in unserem Gehirn vorliegt. In diesem Bereich des Gehirns befinden sich zahlreiche Nervenzellen, die durch weitere Strukturen mit dem limbischen System verbunden sind. […]
DMDD steht für Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Diese Störung wurde nun neu definiert und ins Psychiater-Handbuch übernommen. Bereits jetzt wird Kritik laut, denn DMDD könnte sich zu einer neuen Mode-Diagnose entwickeln. Kinder, die an DMDD leiden werden schnell wütend und schlagen auf alles ein, was sich in ihrer Nähe befindet. Dabei spielt es keine Rolle, […]
Der Mensch kann sich erfreuen und auf der anderen Seite traurig sein. Auch kann er ängstlich oder wütend auf etwas oder jemanden sein. Emotionen, die wir alle kennen und nicht selten selbst erleben. Bisher dachten Experten allerdings, dass der Mensch ausschließlich die nachfolgenden sechs Emotionen empfinden kann: Glück, Trauer, Wut, Ekel, Angst und Überraschung. Ein […]
Aggressionen sind Handlungen, die einen Schaden an Personen oder Sachen verüben. Im Mittelpunkt steht dabei eine aggressive Emotion als Triebfeder. Es gibt allerdings auch Handlungen, die äußerlich aussehen wie eine Aggression, deren Triebfeder allerdings nicht die emotionale Seite ist: Die Pseudoaggression. Pseudoaggressionen ohne psychischen Hintergrund Die Pseudoaggression ist eine Handlung, die nicht primär die Aufgabe […]
Jeder kennt es und hat es selbst schon einmal erlebt: Die Situation, in der die unbändige Wut ausbricht und heiß glühend aus der Magenkuhle in den hitzigen Kopf steigt. Das Herz rast, Bewegungsdrang und Aggressivität steigern sich – und das alles nur, weil uns die Technik einen Streich spielt. Mal passiert es, weil das Navi […]