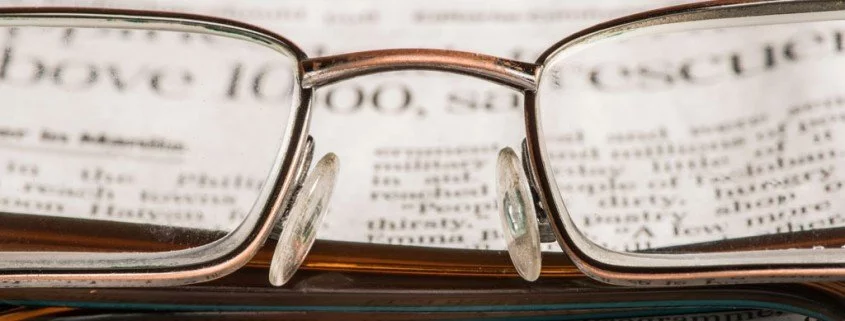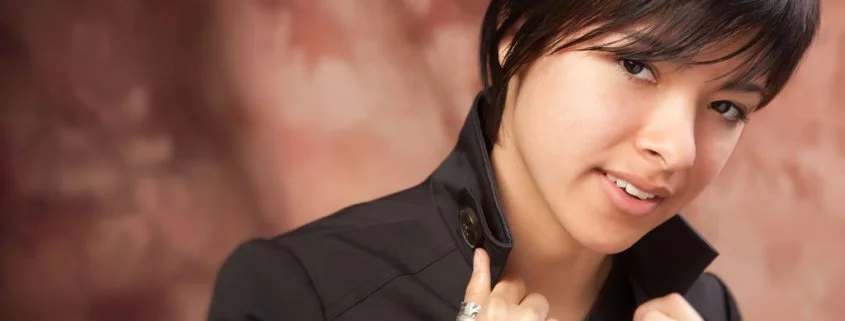In den USA sind Forscher wohl auf einen Gesichtsausdruck gestoßen, der allgemein als Nein-Gesicht bezeichnet werden kann. Dieser Ausdruck bringt vor allem Ablehnung und Verneinung zum Ausdruck. Der negative Ausdruck wird meist durch zusammengepresste Lippen, Stirnrunzeln oder ein hochgezogenes Kinn signalisiert. Im Fachjournal „Cognition“ wurde eine Studie veröffentlicht, die das negative Gesicht bezeichnet. Des Weiteren […]
Schlagwortarchiv für: Studie
Du bist hier: Home » Studie
Beiträge
Es gibt sie immer wieder: Die Besserweisser, Alleskönner, die selbsternannten Experten. Forscher aus Ithaca haben nun herausgefunden, dass sogenannte Experten, die sich einem bestimmten Bereich zuordnen, auch falsches Wissen für sich beanspruchen, demnach also auch zur Selbstüberschätzung neigen. Forscher um Stav Avir von der Universität Cornell in Ithaca haben eine Reihe von Experimenten zu dem […]
Die Augen eines Menschen gelten als Spiegel zur Seele und ein Blick sagt mehr als tausend Worte: Aussagen, die Viele sicher schon gehört haben und die durchaus ihre Berechtigung haben. Nicht umsonst werden unter anderem der Augenkontakt und die Pupillenweitung bei Lügendetektortests angewendet. Auch zwischen Liebespaaren kann ein inniger, vielsagender Blickkontakt wichtig sein und die […]
Psychologen haben jüngst herausgefunden, wieso manche Menschen mehr Glück empfinden können als andere. Desweiteren sind sie zu einem Schluss gekommen, wie man Menschen mit weniger Glück helfen kann. Man kann die Angst vor Spinnen, Schlangen oder Höhenangst nachvollziehen. Die Angst vor dem Glück jedoch ist für viele nicht wirklich verständlich. Diesem Phänomen sind Psychologen auf […]
Bei allem was momentan in der Welt passiert, von der Flüchtlingskrise über den Ukrainekrieg bis zum Terror der IS-Miliz, ist es kein Wunder, dass die aktuellen Nachrichten nicht besonders positiv wirken. Beinahe die Hälfte der Bevölkerung bemängelt, diese Art von Fernsehnachrichten seien zu negativ und würden schockieren. Nachrichten machen schlechte Laune Eine Forsa-Umfrage ergab, dass 45 Prozent der Befragten […]
Während eine erst vor kurzem erschienene Studie davon ausgeht, dass das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, durch das Spielen von Actionspielen steigt, haben andere Untersuchungen sogar positive Effekte – wie Schlauheit und Schnelligkeit – durch Videospiele festgestellt. Neue Studie zur Auswirkung von Videospielen Unter begeisterten Videospielern sorgte ein Bericht über eine neue Studie im Wissenschaftsmagazin […]
Spaziergänge, egal im Freien oder auf dem Laufband sollen die Kreativität erhöhen. Der Ideenreichtum nimmt zu und es entstehen außergewöhnliche Geistesblitze. An der Stanford University wurde durch eine Studie untersucht, ob das Gehen tatsächlich Einfluss auf die Kreativität und Ideenfindung hat. Klar ist inzwischen, dass die erhöhte Kreativität nicht auf erhöhte körperliche Aktivität zurückzuführen ist. […]
Jeder Mensch lügt am Tag durchschnittlich zwei mal, das haben jetzt Forscher aus den Niederlanden, Belgien und den USA festgestellt. Am häufigsten lügen laut Forschern Jugendliche, nämlich 13 bis 17 mal. Über 1000 Menschen wurden durch die Forscher aus den drei Ländern befragt und dabei stellte sich heraus, dass jeder von uns wohl im Durchschnitt […]
Wenn wir Schutzkleidung, wie etwa einen Helm, tragen sind wir waghalsiger und gehen eher Risikos ein. Eine Studie zeigt nun, dass dies nicht nur für sportliche Aktivitäten gilt, sondern auch auf Glücksspiele zutrifft. Versteckter Risiko-Test Die Psychologen Ian Walker und Tim Gamble von der University of Bath haben in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass Menschen, […]
Britischer Forscher sind der Meinung, dass Magic Mushrooms zahlreichen schwer kranken Menschen helfen könnten. Das gilt vor allem für Patienten mit schweren Depressionen. Bei zwölf Testpersonen wurde der Wirkstoff von Magic Mushrooms getestet, Psilocybin. Die einzige Voraussetzung für die Studie war, dass alle anderen Medikamente bei den Probanden zuvor ohne Erfolg getestet wurden. Die Wissenschaftler […]
Wenn wir als Konsumenten wissen, dass das Fleisch aus artgerechter Haltung stammt, dann schmeckt es uns automatisch besser. Das ist sogar dann der Fall, wenn es keinerlei Unterschiede im Geschmack gibt. Geschmacksillusionen beim gleichen Fleisch? Viele Menschen achten mittlerweile beim Einkaufen sehr darauf, ob Fleisch aus artgerechter Haltung stammt oder nicht. Lisa Feldman und ihr […]
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der Westen in Deutschland immer narzisstischer wird. Steht uns eine narzisstische Epidemie bevor? In östlichen Teilen halten die Menschen zusammen und sorgen für einander. Geht man jedoch weiter in den Westen, wird man vom rauen Kapitalismus erdrückt. Die Gesellschaft im Westen besteht nur noch aus selbstbezogenen Egoisten die von einem Schleier […]
Wer schon einmal mit einer Person, die unter Trennungsangst litt, eine Beziehung geführt hat, weiß, wie anstrengend und problematisch es sein kann. Auch Menschen, die über sich selbst wissen, dass sie unter Trennungsangst leiden, stört das oft selbst. Für sie ist es sehr schwer ist eine gesunde Beziehung zu führen und sich komplett auf einen […]
Unsere Lese- und Schreibrichtung hat großen Einfluss auf unsere räumliche Vorstellung. Diese Tendenz konnte bereits in vielen verschiedenen Studien von Sprachwissenschaftlern nachgewiesen werden. In Kulturen, in denen von links nach rechts geschrieben wird, stellen wir uns das Bild zum Satz „Paul schenkt Anna eine Blume“ so vor: Paul als aktiver Part und Subjekt im Satz […]
Jeder kennt dieses Gefühl aus Horrorfilmen wenn das eigene Blut scheinbar erstarrt. Es scheint, als ob unser Blut in den Adern gefrieren würde. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass es sich dabei wohl nicht nur um einen Mythos handelt, sondern eine wahre Geschichte. Der Spruch „Vor Grauen erstarrt mir das Blut in den Adern“ geht wohl […]