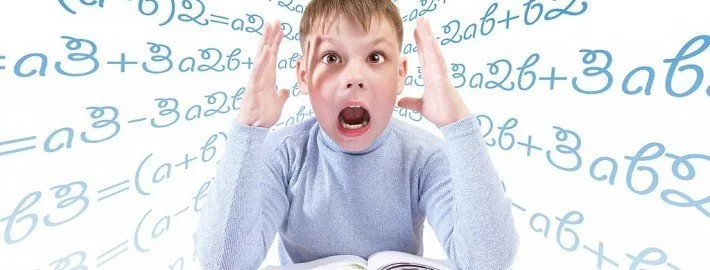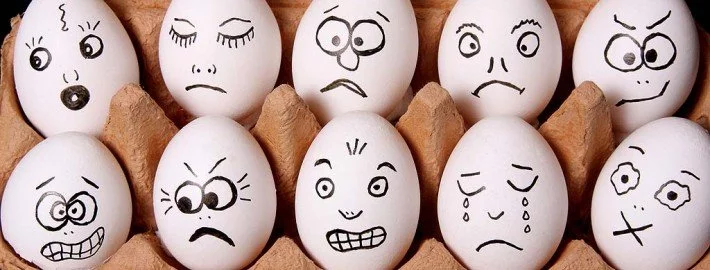Angst ist ein Gefühl, das jeder Mensch in seinem Leben mal empfindet. Nicht bei jedem ist Angst allerdings auf gleiche Weise ausgeprägt. Vielmehr gibt es viele verschiedene Intensitäten dieses Gefühls. Zugleich können sich die Ängste des Menschen auf unterschiedliche Objekte und Situationen beziehen, die ebenfalls nicht bei jedem Menschen in identischer Weise vorliegen. Angst ist […]
Schlagwortarchiv für: Phobie
Du bist hier: Home » Phobie
Beiträge
Angststörungen und Phobien beruhen auf natürlichen Reaktionen, die sich auf falsche Bewertungen gründen. Die Bewertung einer Situation oder eines Objekts als gefährlich führt schließlich zur Angstreaktion, die bei den Störungen übersteigert ist. Die Intensität sowie die körperlichen Reaktionen können stark ausgeprägt sein. Eine fundierte Therapie der Angststörung oder Phobie basiert daher meistens auf einer Kombination […]
Angst ist ein natürliches Gefühl, das den Menschen in erster Linie schützen soll. Bei vielen Personen modifiziert sich die natürliche Reaktion auf eine reale oder vorgestellte Bedrohung und das Ergebnis daraus kann schließlich eine übersteigerte Angst sein, die dann zu einer psychiatrisch relevanten Störung wird. Psychiater sprechen an dieser Stelle von Angststörungen oder Phobien. Bleibt […]
Emetophobie ist eine oft missverstandene Angst, welche zu den phobischen Erkrankungen zählt. Der Unterschied zwischen Furcht und Angst ist, dass eine Furcht begründet ist, eine Angst nicht. Die Diskrepanz zwischen Ängsten und Phobien besteht darin, dass Phobien Angstzustände darstellen, die einen konkreten, zu benennenden Auslöser haben. Maßgeblich belastend ist, dass die Ursache für den ausgelösten Zustand nicht […]
Der Bereich der Angststörungen hat über die letzten Jahre hinweg zahlreiche neue Phobien in sich vereint. Angst beschäftigt einen Jeden einmal, doch bei Phobien verschärfen sich diese Angstzustände so drastisch, dass sie das Leben des Betroffenen entscheidend beeinträchtigen. Die Emetophobie beschreibt eine solche Angststörung, bei der sich der Phobiker vor dem Erbrechen fürchtet. Diese Furcht […]
Erythrophobie ist die Panik vor dem Erröten. Es ist eine soziale Phobie und Angst, die den Alltag von vielen Patienten in Deutschland bestimmt. Sie kann viele Gesichter haben und tritt in den letzten Jahren mit dem steigenden Leistungsdruck und größerer Anonymität vor allem in den jüngeren Generationen vermehrt auf. Nicht selten wird eine Angsterkrankung schließlich […]
Leidest Du an Arachnophobie, ekelst auch Du dich vor Spinnen? Es gibt Grund zur Hoffnung – Wissenschaftler aus den Niederlanden haben nun ein neues Behandlungskonzept vorgestellt. Durch ihre Methode soll es möglich sein, Menschen in kurzer Zeit von ihrer Spinnenangst zu heilen. In der Fachzeitschrift Biological Psychiatry veröffentlichten die Forscher nun die Ergebnisse ihrer Studie. […]
Phobien sind weit verbreitet. Fast weiß um die Panik vor Spinnen oder großen Höhen. Allerdings kann eine Person auch gegenüber jedem anderen Objekt oder jeder Situation eine Angst entwickeln, die sich im gesteigerten Maß als Phobie äußert. Für einige Menschen ist die Störung sogar belastend und führt schließlich zu einer Einschränkung des Lebens. Was ist […]
Die Soziale Angst bzw. Phobie gehört im wesentlichen in den Bereich der Angststörungen. Obwohl anzunehmen ist, dass die Störungen eher selten sind, treten sie immerhin bei bis zu zehn Prozent der Bevölkerung auf. Häufig werden die Störungen nicht erkannt, da die auslösenden Situationen von den Betroffenen vermieden werden. Was ist soziale Angst / Phobie? Bei einer […]
Sozialphobiker durchleben den Alltag wie einen Hürdenlauf. Für sie sind alltäglichste Verrichtungen, wie einen Friseurtermin zu vereinbaren oder Smalltalk an der Kasse zu führen, Stresssituationen. Ihr Herzschlag erhöht sich, sie zittern vor Angst und bekommen Schweißausbrüche. Soziale Interaktionen sind für sie angstbesetzt. Daher isolieren sich viele Sozialphobiker von der Gesellschaft. Angst äußert sich bei jedem […]
Die Angst vor Spinnen ist weit verbreitet. Es sind in der Hauptsache Frauen, die beim Anblick einer Spinne in helle Panik verfallen, aber es gibt auch Männer, die in solchen Situationen panisch werden und nach Hilfe rufen. Die meisten Menschen mögen keine Spinnen, aber es stellt für sie kein Problem dar, einen ungeliebten Mitbewohner mit […]