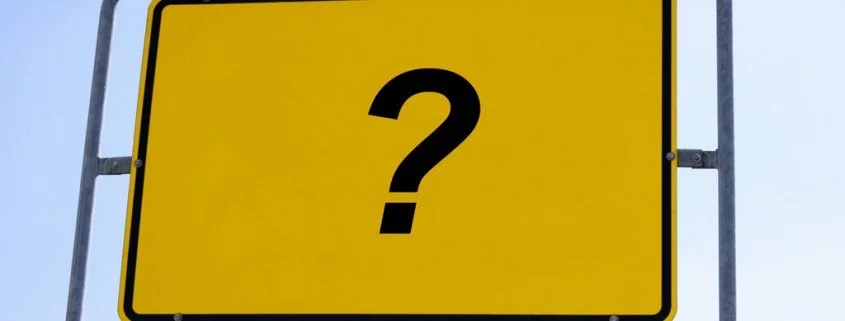Der Narzissmus geht auf einen griechischen Mythos zurück, bei dem der Jüngling Narziss die Liebe der Nymphe Echo zurückweist. Zur Bestrafung belegt ihn Aphrodite mit einem Fluch, der ihn in einen Zustand der unendlichen Selbstliebe versetzt, welche ihm später zum Verhängnis wird. Die verliebte Selbstbetrachtung des Narziss im Spiegel des Gewässers steht bildhaft für diese […]
Schlagwortarchiv für: Narzissmus
Du bist hier: Home » Narzissmus
Beiträge
In der heutigen Ellenbogen- Gesellschaft wird dieser Typ Mensch immer bekannter: Der Narzisst. Der Narzisst liebt lediglich sich selbst. Sein Charakter zeichnet sich ja eben durch die Selbstliebe zu dem Bild, das er von sich hat, aus. Dieser Begriff geht auf den griechischen Mythos des Jünglings Narziss zurück, der sich verliebt wähnt, als er sein […]
Der Begriff Narzissmus geht auf die griechische Mythologie zurück. Narziss war ein viel umworbener Jüngling, der aus Stolz auf seine eigene Schönheit alle Bewerber zurückwies. Einer der Abgewiesenen rief die Götter an, Narziss für sein Verhalten zu bestrafen. Die Götter erhörten ihn und straften Narziss mit unstillbarer Selbstliebe. Er verfiel seinem eigenen Spiegelbild, das er […]
Psychologie-Tests können in vielerlei Hinsicht eingesetzt werden. Entweder ermittelt man auf diese Weise die Gefahr an Burnout zu erkranken oder wie es um das eigene Selbstbewusstsein bestellt ist. Auch in Hinblick auf die Diagnose Narzissmus kann ein psychologischer Narzissmus-Tests Wunder wirken. Ein bekannter und fundierter Test zu dieser Persönlichkeitsstörung ist der Narcissistic Personality Inventory (NPI). […]
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der Westen in Deutschland immer narzisstischer wird. Steht uns eine narzisstische Epidemie bevor? In östlichen Teilen halten die Menschen zusammen und sorgen für einander. Geht man jedoch weiter in den Westen, wird man vom rauen Kapitalismus erdrückt. Die Gesellschaft im Westen besteht nur noch aus selbstbezogenen Egoisten die von einem Schleier […]
„Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?“ – bei der Königin aus Schneewittchen handelt es sich ganz sicher um eine narzisstische Gestalt. Doch nicht nur bei den Gebrüdern Grimm kommen sie vor, sondern auch im echten Leben. Sie haben sicher auch mit ihnen zu tun – den Narzissten. Einerseits unwahrscheinlich charmant, […]
Immer mehr Eltern erliegen dem Gedanken, dass ihr Kind etwas Besonderes ist. Diese Besonderheit bezieht sich dabei nicht auf die Wesensart des Kindes, sondern auf seine Leistungen. Unsere heutige Leistungsgesellschaft suggeriert uns, dass nur sehr fleißige und begabte Kinder „weit im Leben kommen“. Wenn Eltern diesen Gedanken allerdings auf ihre Kinder übertragen, kann es bei […]
Es scheint als sei die Welt heutzutage voll von ihnen: Narzissten. Sie erstellen fortlaufend Selfies, bewundern sich im Schaufenster und es mangelt ihnen offensichtlich an Empathie. Die drei prägnantesten Symptome eines Narzissten sind Gefallsucht, Empathiemangel und Übermut. Doch sind wir dann nicht alle ein bisschen narzisstisch? Positiver Narzissmus und Maskeraden Unter positivem Narzissmus verstehen Psychologen […]