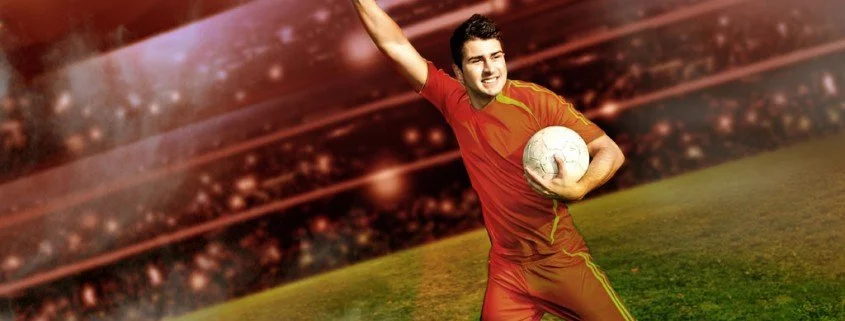Am 30. November jährt sich der Tod Robert Enkes. Die Fußballwelt erfuhr an diesem Tag nicht nur vom Freitod des beliebten Torwarts, sondern auch davon, dass Depressionen hinter dieser tragischen Geschichte standen. Erstmals sprach man offen über die Problematik, von der nicht nur Fußballer, sondern auch andere Spitzensportler betroffen sind. Robert Enkes Tod hat eine Diskussion in Gang gesetzt, […]
Schlagwortarchiv für: Fußball
Du bist hier: Home » Fußball
Beiträge
Wir Normalsterblichen können uns gar nicht das Ausmaß des psychischen Drucks ausmalen, welcher auf den Schultern eines Sportlers in einer entscheidenden Spielsituation lastet. Der weltbekannte Italiener Robert Baggio versagte unter diesem Druck kläglich bei der Fußball-WM im Jahre 1994, indem er einen Elfmeter verschoss, der seine Mannschaft den Sieg kostete. Der Psychologe Georg Froses von […]
Deutschland ist Weltmeister 2014. Ein wahres Sommermärchen überzieht das ganze Land. Teamgeist, Spielerstärke und Mannschaftsgeist sind aktueller denn je. Deshalb fragen wir uns heute: Was können Kinder im Mannschaftssport Fußball lernen? Spaß am Spiel Der beste Motivator ist immernoch Spaß. Wenn Kinder Spaß am Ballspielen empfinden, lässt sich diese Sportart ganz leicht in den Alltag […]
Fußballspiele berühren zahlreiche Zuschauer auf ganz individuelle Art und Weise. Doch wie flüchtig ist eigentlich das Glück, das sich nach einem gewonnenen Spiel einstellt? Wie „haltbar“ sind diese oft so intensiven Emotionen wirklich? Psychologen der Universität Konstanz haben sich dieser Frage mal genauer angenommen und haben Interessantes eruiert. Die Basis der Studie ist die Weltmeisterschaft […]