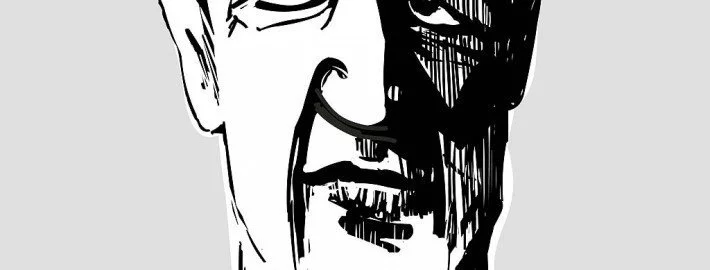Ca. 150.000 Menschen sind von Autismus betroffen, ca. 300.000 Menschen leiden unter einer Autismus-Spektrum-Störung, einer abgeschwächten Abwandlung von Autismus. In beiden Fällen handelt sich um eine tief- und weitgreifende Störung der Entwicklung, die sich ca. im dritten Lebensjahr erstmalig zeigt. Für Eltern und Familien der betroffenen Kinder ist die Krankheit im doppelten Sinn eine Herausforderung. […]
Schlagwortarchiv für: Autismus
Du bist hier: Home » Autismus
Beiträge
Die Linie zwischen Autismus und Hochbegabung ist oft sehr schmal bzw. schließt Autismus die Hochbegabung nicht aus. Anders herum haben hochbegabte Kinder nicht selten autistische Züge, deshalb aber nicht gleichermaßen eine Entwicklungsstörung. In jedem Falle gilt diesen Kindern eine besondere Aufmerksamkeit. Sie haben eine andere Auffassungsgabe und eine andere Weltsicht. Aus diesem Grunde gilt es […]
Autistische Menschen unterscheiden sich in ihrem Verhalten grundsätzlich stark von ihrer Umwelt. Auffällig ist, dass offenbar mehr Männer und Jungen unter dieser Krankheit leiden als Frauen und Mädchen. In der Regel wird Autismus meist bereits im Säuglings- und Kleinkindalter festgestellt. Symptome Autisten sind kaum in der Lage Blickkontakt zu ihren Mitmenschen aufzunehmen. Sie lächeln nicht […]
Autismus ist eine ernstzunehmende Krankheit. Viele Psychiater und Wissenschaftler interessieren sich für dieses inzwischen weit verbreitete Syndrom und richten ihre Forschung darauf aus, denn besonders in den USA wird seit einigen Jahren ein rasanter Anstieg an Betroffenen beobachtet. Bislang ist die Ursache unklar, doch tagtäglich gibt es neue interessante Informationen, die bei der Behandlung und […]
Autismus ist eine Entwicklungsstörung, die sich durch die Vermeidung von sozialen Kontakten gepaart mit besonderen Fähigkeiten äußert. Insgesamt gibt es etwa 60 verschiedene Symptome, wobei die zwei genannten Symptome am Häufigsten auftreten. Männer sind der aktuellen Studienlange zufolge etwa vier Mal so häufig von Autismus betroffen wie Frauen. Die geschätzte Zahl der in Deutschland diagnostizierten […]
Der österreichische Arzt Hans Asperger war es, der in den 1940er Jahren die nach ihm benannte Krankheit erstmals beschrieben hat. Seiner Erkenntnis nach handelt es sich dabei um eine Entwicklungsstörung, die autistische Züge trägt. Anders als beim Autismus sind die Symptome beim Asperger Syndrom jedoch schwächer ausgeprägt. Jedoch besteht beim Asperger Syndrom leicht die Gefahr, sie mit […]
Viele haben wohl schon einmal von der Diagnose Autismus gehört. Fragt man, wie sich die Krankheit äußert können doch nur wenige antworten. Die Krankheit, die statistisch gesehen mehr Jungen als Mädchen betrifft, wird zumeist schon im Kindesalter erkannt. Eine autistische Störung ist eine tiefgreifende Störung der Entwicklung. Der Psychologe Leo Kanner berichtete erstmals von der Störung. Das […]
Nicht jeder Autist ist absolut gefühlskalt! Laut Forschern aus Wien und Triest handelt es sich dabei vielmehr um ein Syndrom namens Alexithymie. Oft hört man, dass Autisten gefühllos und kalt sind. Dieses Image wurde durch den Amoklauf 2015 in Oregon verstärkt als der 26 jährige Täter als Autist diagnostiziert wurde. Es wurde nach dem Amoklauf […]
Für Forschungen im Autismus-Bereich gingen chinesische Forscher nun einen Schritt weiter, als ihre Kollegen. Sie züchteten autistische Affen. Diese Affen sind sehr viel ängstlichere und weniger sozial als ihre nicht-autistischen Artgenossen. Die Forscher erhoffen sich, durch verschiedene Tests an Affen ein Mittel gegen Autismus zu finden. Nach eigenen Angaben haben chinesische Forscher es wohl über Genveränderungen […]
Wenn die Väter zum Zeitpunkt der Geburt der Söhne bereits im fortgeschrittenen Alter sind, entwickeln sie laut Wissenschaftlern häufiger spezielle Interessen. Kinder entwickeln Nerd-Eigenschaften Wissenschaftler vom King’s College in London haben herausgefunden, dass Söhne im Alter von zwölf Jahren typische Nerd-Eigenschaften entwickeln, je älter die Väter sind. Dazu haben die Forscher Daten von Zwillingen aus […]
Autismus gilt immer noch als relativ unbekannte Krankheit. Einem Autisten sieht man seine Krankheit nicht unbedingt auf den ersten Blick an. Oft dauert es viele Jahre, bis eine Diagnose den Anfangsverdacht schließlich bestätigt. Zum Glück geht das heute sehr viel schneller, als noch vor wenigen Jahren. Gerade bei Kindern hat sich da viel getan. Heute erkennen […]