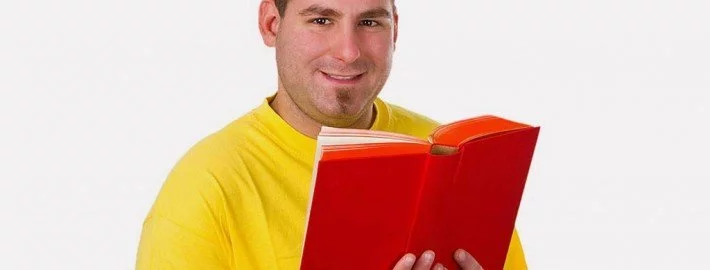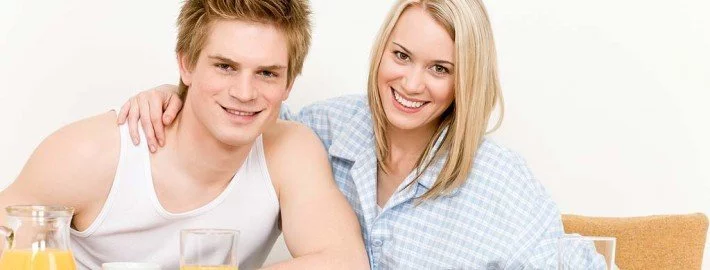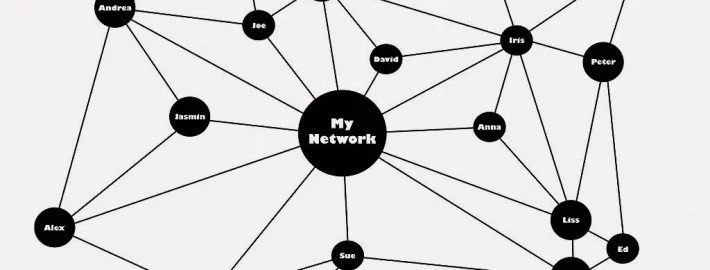Übergewicht wird immer mehr zum Problem. Dabei sind es nicht nur Erwachsene, die zu viel auf den Rippen haben, das Thema Übergewicht oder gar Fettleibigkeit betrifft zunehmend auch immer mehr Kinder. Dabei wird der Grundstein für das Gewicht im Erwachsenenalter in der Regel schon in der Kindheit gelegt. Wer also schon im Kindergarten oder der […]
Archiv für die Kategorie: Eltern & Erziehung
Du bist hier: Home » Eltern & Erziehung » Seite 5
Psychologie – Eltern & Erziehung
Mehr als 100.000 Menschen in Deutschland sind das Ergebnis einer anonymen Samenspende. Es wird in einigen Studien davon ausgegangen, dass jedoch nur 5-10% der Männer und Frauen davon etwas wissen. Mit verschiedenen Fragen sollten sich die werdenden Eltern schon im Vorhinein beschäftigen. Sage ich es meinem Kind? Wenn ja, wie sage ich es? Wie kann […]
ADHS ist vor allem aufgrund der gesteigerten Medienpräsenz diese Thematik betreffend, inzwischen jedermann bekannt. Offiziell handelt es sich dabei um eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Kinder, bei denen diese Diagnose gestellt ist, werden in den meisten Fällen mit Medikamenten behandelt, um die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und ihre ausschweifenden Emotionen in den Griff zu bekommen. Statistiken lassen […]
Welche Maßnahmen können ergriffen werden? Eine Essstörung beeinträchtigt das Leben in vielen Bereichen. Magersucht und Bulimie haben in der Regel immer gesundheitliche Folgen für Betroffene. Für Frauen, die an einer Essstörung leiden, aber dennoch den Wunsch haben, ein Kind zu bekommen, gibt es einiges zu bedenken. Es ist wichtig zu überlegen, ob die Magersucht in […]
Unruhige Kinder, die in der Schule oder bei den Hausaufgaben unkonzentriert sind, bekommen häufig übereilt den Stempel ADHS aufgedrückt. Rund drei bis zehn Prozent der Kinder in Deutschland leiden unter der Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung. Die Diagnose ADHS wird jedoch viel häufiger gestellt, obwohl die Symptome nicht eindeutig zugeordnet werden können. In vielen Fällen verschreiben die Ärzte auch […]
Entgegen der weitläufigen Meinung handelt es sich bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung um keine Erkrankung, die nur im Kindes- oder Jugendalter auftritt. Bei ungefähr 60 Prozent der an ADHS-erkrankten Kinder tritt die Störung auch im Erwachsenenalter noch auf. In vielen Fällen bleibt bei Depressionen, Angst- oder Suchtkrankheiten die eigentliche Ursache verborgen. Denn nur die wenigsten Erwachsenen werden […]
In den meisten Partnerschaften kommt irgendwann ein Kinderwunsch auf. Bereits während der Schwangerschaft beginnen die jungen Eltern, sich vorzustellen, wie es sein wird, wenn das Kind auf der Welt ist. Vorstellungen, die teilweise unrealistisch sind, da sie häufig nur von den positiven Seiten geprägt sind. Vergessen wird, dass die Rollen komplett neu geschrieben werden müssen, damit […]
Die Eltern-Kind-Beziehung ist eine besondere zwischenmenschliche Beziehung. Eltern kümmern sich um ihr Kind und für viele ist die Geburt des Nachwuchses der Schritt zu einer “echten Familie”. Die Eltern-Kind-Beziehung verändert sich dabei im Verlauf des Lebens und von einer beschützenden Beziehung geht das Verhältnis irgendwann in eine gleichberechtigte Stellung über. Die Eltern-Kind-Beziehung im Verlauf des Lebens […]
Die Kinderzimmer sind voll von Technik. Computern, Fernseher und Co. begleiten die Kinder heute durch ihre Kindheit. Daher erscheint es den Eltern sehr oft als gute Möglichkeit, diese auch als Strafe für ein Fehlverhalten zu instrumentalisieren. Ein Fehler, denn damit werden die Grundsätze einer guten Pädagogik missachtet. Wirksam und dennoch nicht sinnvoll Zwar hat heute […]
Vorlesen hat Tradition. Viele Eltern lesen ihren Kindern täglich kurz vor dem Schlafengehen vor und auch in einigen weiteren Situationen ist das Vorlesen durchaus gängige Praxis. So soll es bleiben, denn neuere Studien zeigen nun: Das Vorlesen verbessert auch die Schulnoten und beeinflusst den Menschen auch in anderen Bereichen positiv. Eine großangelegte Studie In einer […]
Die klassische Familie besteht aus Vater, Mutter und mindestens einem Kind. Im Verlauf der Zeiten haben sich allerdings viele weitere Beziehungsmodelle etabliert, die heute gängige Praxis sind. Die Zeiten, in denen geheiratet werden musste, um eine legitime Partnerschaft führen zu können, sind ebenfalls vorbei. Daher gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die an den jeweiligen Lebensstil […]
Die Zeiten ändern sich. Und mit ihnen auch die Menschen, wie neue Studien belegen. Was schon fast Tradition war, wird nun immer mehr durch ein neues Bild von Mann und Frau geprägt. Dies gilt nicht mehr nur im privaten Bereich – auch der Beruf und die Karriere wird von den Geschlechtern unterschiedlich behandelt. Studien belegen […]
Die Ehe retten – der Wunsch vieler verzweifelter Menschen. Häufig fühlen sich Ehepartner nach einiger Zeit voneinander entfremdet und es wird kaum mehr miteinander kommuniziert. Der Partner scheint seinen Gegenüber zu ignorieren und auch die Erotik ist nahezu nicht mehr vorhanden. Zugleich kann die Partnerschaft hinter den alltäglichen Verpflichtungen in den Hintergrund treten. Miteinander reden […]
Frühförderung ist heute ein allgegenwärtiger Begriff. Die Kinder werden in Klavierunterricht, Babyschwimmen und manch andere Kurse geschickt. Immer dabei sind die Eltern. Sie möchten mit der Frühförderung erreichen, dass ihr Kind ganz oben mitmischt und später die besten Chancen hat. Doch wenn nur der Beste zählt, welche Chancen haben dann die Dritten? Und zugleich: Frühförderung […]
Schwangerschaft und das sogenannte “Bauch tätscheln” gehen Hand in Hand. Fast jede Schwangere kennt die Berührungen des Bauchs von teilweise wildfremden Personen. Dass in der Schwangerschaft dieses Verhalten von wildfremden Personen ebenfalls gezeigt wird und nahezu gar nicht nachlässt, ist für die Betroffene allerdings meistens nur schwer zu ertragen und nervig. Woher das Phänomen kommt […]
Babys sind niedlich – sicherlich. Sie können aber auch täuschen und tricksen. Dieser Umstand wurde von englischen Forschern entdeckt. Zwar sind ihre Mittel begrenzt, um die Eltern effektiv zu täuschen – schließlich weinen und lachen die Babys zunächst nur – doch genau diese Eigenschaften werden von den Kleinen durchaus sehr effizient eingesetzt, wie die Forscher […]
Jeder Mensch hat ein Selbstbild. Dieses Selbstbild beinhaltet – wie es die Theorie des Johari-Fensters aussagt – Bereiche, welche nur die Person über sich selbst weiß. Zudem gibt es Bereiche, die nur der Umwelt bekannt sind und jene, über die sowohl die Person als auch deren Umwelt im Klaren sind. Unschwer lässt sich bereits in […]
Wenn Eltern nach einem Vornamen für ihr Kind suchen, sollten sie sich nicht nur nach dem eigenen Geschmack oder der jeweils vorherrschenden Mode richten, sondern auch in Betracht ziehen, welchen Einfluss die Namensgebung auf das Leben des Kindes nehmen könnte. An der TU Chemnitz setzten sich Prof. Dr. Udo Rudolph und die Diplomanden Michaela Lummer und […]
Auch wenn die Mutter häufig als wichtigste Person im Zusammenhang mit der Prägung und Erziehung des Kindes genannt wird: Neue Studien weisen in eine andere Richtung. Grundsätzlich scheint die Vaterliebe für die Entwicklung und Prägung in gleicher Weise wichtig zu sein wie auch das weibliche Geschlecht. Wie äußert sich die Vaterliebe und was passiert, wenn sie […]
Mutterliebe ist das größte Geschenk, das ein Baby oder Kleinkind für seine spätere seelische Entwicklung bekommen kann. Erwachsene, die als Kind viel Wärme, Liebe und Fürsorge durch die Mutter erfahren haben, sind den Anforderungen des Lebens besser gewachsen und verfügen über eine höhere Stressresistenz. Fehlt die Liebe der Mutter, bzw. wird sie nicht intensiv genug […]