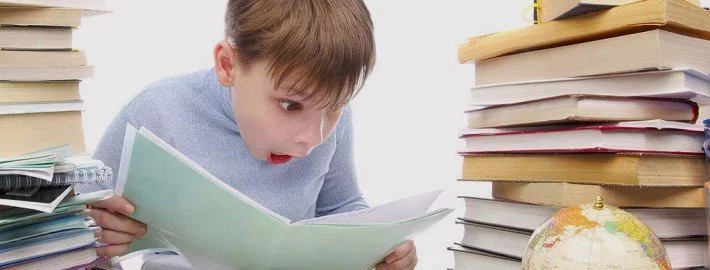Eine Entbindung ist ein ganz besonderer Moment im Leben einer werdenden Mutter. Aus Angst vor Schmerzen und Komplikationen greifen inzwischen viele Frauen auf die Möglichkeit eines freiwilligen Kaiserschnitts zurück. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen keinerlei Angst vor der Entbindung bestand und Betroffene trotzdem ein Geburtstrauma entwickeln. Mit diesem Terminus sind peripartale – also […]
Archiv für die Kategorie: Eltern & Erziehung
Du bist hier: Home » Eltern & Erziehung » Seite 4
Psychologie – Eltern & Erziehung
Eine gesundheitliche Beratung und Gymnastik-Kurse begleiten jede Schwangerschaft. Wichtig ist bei der Vorbereitung auf die Schwangerschaft und die Geburt aber auch und vor allem das psychische Befinden der Mutter, denn diese hat sowohl Auswirkungen auf die Gesundheit der Mutter und des Fötus als auch deren psychische Entwicklung. Besonders die Auswirkungen der psychischen Befindlichkeit der Mutter auf […]
Wie gestalt jemand sein Leben, der durch besondere individuelle körperliche und geistige Gegebenheiten einen ganz anderen Zugang zur Welt als die meisten seiner Mitmenschen hat? Für viele psychisch kranke Menschen oder solche, die mit den Spätfolgen einer psychischen Störung leben müssen, sind diese Fragen elementar. Eine Möglichkeit diese Schicksale zu mildern und sie an ein […]
Welches Kind hört schon gerne „Du bist genau wie deine Mutter“ oder Aussagen wie „Das hat dein Vater früher auch immer gemacht“. Ganz klar: wir sind die Kinder unserer Eltern, aber in manchen Situationen sind wir das nicht unbedingt gerne, denn auch an unseren Eltern nerven uns manche Angewohnheiten. Eine neue Studie hat nun ergeben, […]
Die Geburt eines Kindes verändert nicht nur jede Paarbeziehung und das Alltagsleben enorm, sondern auch die eigene Psyche. Nicht alle werdenden Eltern fühlen sich sogleich bereit für diesen großen Einschnitt im Leben einer Familie und oftmals kommen Zweifel auf. Werden diese Zweifel für werdende Mütter zu einer Qual, die sich nicht mehr so einfach aus […]
Traumata lassen sich nicht immer schnell und einwandfrei diagnostizieren. Besonders bei Kindern stellt eine traumatische Erfahrung behandelnde Ärzte oftmals vor große Anforderungen. Kinder sprechen nicht immer gerne mit ihren Eltern oder Freunden über traumatische Erlebnisse und meist fällt es ihnen schwer das Erlebte richtig zu erfassen. Stattdessen flüchten sie sich in Traumwelten und erfinden eine […]
Der Begriff Kindesmisshandlung ist heute in aller Munde. Anders als in früheren Jahren und Jahrzehnten sieht man die körperliche und seelische Bestrafung von Kindern heute mit ganz anderen Augen. Von vielen Erziehungsmethoden, die noch von wenigen Jahren üblich waren, rücken moderne Eltern und Erzieher weit ab. Der Begriff Kindesmisshandlung umschreibt die psychische und physische Schädigung von Kindern […]
Autismus gilt immer noch als relativ unbekannte Krankheit. Einem Autisten sieht man seine Krankheit nicht unbedingt auf den ersten Blick an. Oft dauert es viele Jahre, bis eine Diagnose den Anfangsverdacht schließlich bestätigt. Zum Glück geht das heute sehr viel schneller, als noch vor wenigen Jahren. Gerade bei Kindern hat sich da viel getan. Heute erkennen […]
Burn-out wurde lange als Managerkrankheit gehandelt. Der immense Stress sich um Untergebene zu kümmern, Jahreabschlüsse zu planen und erfolgreiche Projekte vorweisen zu können, bringt so manchen an seine seelischen und körperlichen Grenzen. Doch dabei vergisst man schnell, dass auch Mütter unter immensem Druck stehen ihren Kindern, dem Haushalt und Eheleben gerecht zu werden. Wenn sie […]
Autismus ist eine ernstzunehmende Krankheit. Viele Psychiater und Wissenschaftler interessieren sich für dieses inzwischen weit verbreitete Syndrom und richten ihre Forschung darauf aus, denn besonders in den USA wird seit einigen Jahren ein rasanter Anstieg an Betroffenen beobachtet. Bislang ist die Ursache unklar, doch tagtäglich gibt es neue interessante Informationen, die bei der Behandlung und […]
Einer Studie zufolge werden die Kinder und Jugendlichen in Deutschland immer unglücklicher. Man könnte meinen, es handle sich dabei um ein Jammern auf höchstem Niveau, dabei liegt hier ein tiefer gehendes Problem zugrunde. Die Lebensbedingungen in unserem Land sind sehr viel besser, als in anderen Ländern und doch fühlt sich die junge Generation zunehmend unglücklich. Dies zeigt eine […]
Sie wird in den Medien eher selten thematisiert, gehört jedoch bei Kindern und Jugendlichen zu den häufigsten Erkrankungen psychischer Natur: Schätzungen gehen davon aus, das bundesweit vier bis acht Prozent der Kinder und Jugendlichen an einer Depression leiden. Im Folgenden wollen wir klären, anhand welcher Symptome eine depressive Verstimmung bzw. Störung erkannt werden kann, welche […]
Unter Mobbing versteht man gemeinhin ein aggressives Verhalten, bei dem ein anderer Mensch entweder körperlich oder psychisch geschädigt wird. In der Regel spielt sich Mobbing nicht nur zwischen zwei Personen ab, also dem Täter und seinem Opfer, da beim Mobbing ganze Gruppen von Menschen an der Aggression beteiligt sein können. Als klassisches Beispiel für Mobbing gelten Hänseleien […]
Religion in der Erziehung? Nicht zuletzt durch den Missbrauchskandal in der katholischen Kirche sehen sich viele in ihrer Meinung bestärkt, das Konzept der Religion sei ein längst überflüssig gewordenes Relikt vergangener Zeiten und habe seit Menschengedenken nur einem Zweck gedient: den Menschen unterwürfig zu machen. Diese Sichtweise mag arg überspitzt klingen, doch was in leidenschaftlichen Tiraden […]
Eine Beziehung steht vor allerlei Schwierigkeiten – so unterschiedlich wie die Menschen sind, so differenziert sind auch deren Ansichten. Muss das Auto ein Porsche sein oder ist doch eine ökologische Treibstofflösung wichtiger? Sollte man lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen? Bei all diesen Fragen kann sich das Paar möglicherweise auf einen Kompromiss einigen. Bei […]
Es gibt wohl kaum ein Kind, das nicht gelegentlich am Daumen lutscht. Der Daumen dient als Trostspender oder Einschlafhilfe und ist praktischerweise immer zur Hand. Das Nuckeln am Daumen scheint darüber hinaus eine ganze Reihe von natürlichen Bedürfnissen des Kindes zu befriedigen. Aber wann ist Daumenlutschen harmlos und wann wird es schädlich? Warum lutschen Babys am Daumen? […]
Immer mehr Eltern erliegen dem Gedanken, dass ihr Kind etwas Besonderes ist. Diese Besonderheit bezieht sich dabei nicht auf die Wesensart des Kindes, sondern auf seine Leistungen. Unsere heutige Leistungsgesellschaft suggeriert uns, dass nur sehr fleißige und begabte Kinder „weit im Leben kommen“. Wenn Eltern diesen Gedanken allerdings auf ihre Kinder übertragen, kann es bei […]
Immer wieder tauchen in der Presse Berichte über Jugendliche auf, die sich an den Wochenenden bis zur Besinnungslosigkeit betrinken. Dies hat bei Eltern und Gesundheitsexperten große Besorgnis ausgelöst. Schließlich möchte niemand gern seinen Sohn oder die Tochter aus dem Krankenhaus abholen müssen. Das sogenannte Komasaufen hat sich scheinbar zu einem Trend entwickelt, dies bestätigen Berichte […]
In Amerika ist der Molekular- und Entwicklungsbiologe John Medina bekannt wie ein bunter Hund. Seine Bücher, in denen er Erkenntnisse der Neurowissenschaften in konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt, finden reißenden Absatz. Nach seinem letzten Buch „Gehirn und Erfolg: 12 Regeln für Schule, Beruf und Alltag“ spricht er nun in seinem neuen Werk vor allem die etwas übermotivierten […]
Sie ist schön, berühmt und erfolgreich: Star-Model und TV-Moderatorin Heidi Klum. Doch bevor sie zu Ruhm und Unabhängigkeit gelangte, war sie ein Kind – das, wie sie gerade der englischen Zeitung “The Times” in einem Interview anvertraute, auch Schläge seitens des strengen Vaters einstecken musste. Ein Schicksal, das sie mit vielen Menschen teilt und aus […]