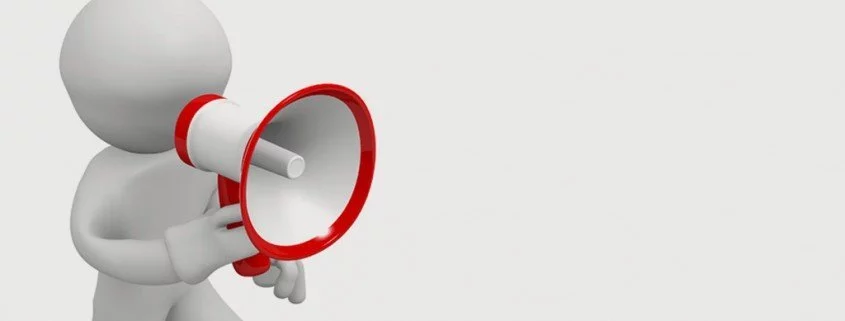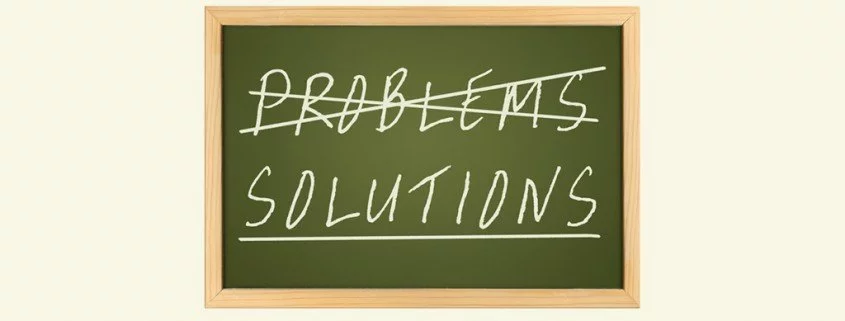Keine Frage, wenn man die Lehrer an deutschen Schulen fragen würde, was sie so gar nicht an ihrem Arbeitsalltag leiden mögen, dann wäre die Antwort sicherlich „Krach“. Doch ganz so einfach ist es meistens nicht. Wie laut es in einem Klassenzimmer wirklich ist, hängt auch immer von der Akustik ab. Dennoch macht Lärm auf Dauer krank. Außerdem […]
Archiv für die Kategorie: News & Storys
Du bist hier: Home » News & Storys » Seite 9
Psychologie News & Storys
Volkskrankheiten wie Diabetes oder Depressionen belasten auch den Staatshaushalt. Das ist eine Wahrheit, die jedem Bundesbürger bewusst sein sollte. Arbeitsunfähigkeit, Krankengelder und Frühberentungen sind große Belastungen und sowohl Politiker als auch Bürger sollten daran interessiert sein, die Rate jener Ausgaben zu senken. Wenn der Mensch krank ist, ist er krank. Soviel ist klar. Doch das Team […]
Eigentlich ist es ja allen klar: Shoppen macht glücklich. Mal Hand aufs Herz: Wenn man sich so richtig ungut fühlt, ist es toll, sich was Gutes zu tun und sich mal was Schönes zu gönnen. Das Gerücht, dass es (nur) bei Frauen vor allem der Kauf von Schuhen ist, der Endorphine freisetzt und damit Glücksgefühle auslöst, ist […]
Träume sind geheimnisvoll. Manchmal werden wir in unseren Träumen verfolgt. Wir rennen so schnell wir können und der Verfolger ist uns dicht auf den Fersen. Wir spüren seinen Atem und vor uns endet der Weg. Es geht mehrere hunderte Meter in die Tiefe, wo ein Fluss fließt. Jetzt sitzen wir in der Falle. Urplötzlich dann […]
Manchmal bricht Singen das Eis. Fremde Menschen kommen sich in kürzerer Zeit durch Chorgesang näher als durch Gruppenaktivitäten. Britische Psychologen berichten, dass Menschen durch Singen schneller zueinander finden als durch Gruppenaktivitäten. Zu dieser Erkenntnis kommen sie vor allem, weil gemeinsame Tätigkeiten soziale Bindungen stärken und das Gefühl der Zusammengehörigkeit wächst. Das Gemeinschaftsgefühl bei Gruppen, die […]
Alle Menschen sind verschieden. Sie sind sich allerdings in vielen Aspekten auch sehr einig. Das gilt nicht nur für unsere Auffassung von menschlichen Grundrechten. Es gilt insbesondere für die uns als Erbe mitgegebenen gemeinsamen menschlichen physischen und psychischen Strukturen und für bestimmte Verhaltensweisen. In einem Interview mit der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Psychologie heute“ gibt der […]
Jede psychische Erkrankung muss professionell in einer Therapie behandelt werden. Mittlerweile gilt diese Art von Erkrankung sogar als Berufskrankheit und ist dementsprechend anerkannt. Man geht heute davon aus, dass etwa ein Zehntel aller Fehltage auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen war. Die häufigste psychische Erkrankung ist die Depression. Seit das Thema Depression und Burnout in aller Munde ist, […]
Bei dem Cotard-Syndrom handelt es sich um eine skurrile Wahnstörung, bei der Lebende sich für wandelnde Tote halten. Eine heute 17-Jährige glaubte, dass sie sich drei Jahre lang in einem toten, organlosen Körper befand. Als Auslöser für die Erkrankung bei Haley Smith (damals 14 Jahre alt) kommt die Scheidung der Eltern in Betracht, die sie […]
Der zum Tod durch Giftspritze verurteilte Mörder Ricky Ray Rector aß nur einen Teil seiner Henkersmahlzeit. Den Rest wollte er sich für später aufheben. Angel Nieves Diaz, 55, aus Florida, verurteilt wegen Mords, Entführung und bewaffneten Raubs, lehnte eine letzte Mahlzeit ab. Er sollte das normale Gefängnisessen bekommen, lehnte aber auch das ab. Das passt zu […]
Dass in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr jüngere und auch bereits erwachsene ein steigendes Mitteilungsbedürfnis haben, lässt sich am Boom sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter unschwer erkennen. Doch sind wirklich alle User kleine Narzissten? Eine Studie der University of Michigan unter der Leitung des Kommunikationswissenschaftlers Elliot Panek soll Licht ins Dunkle bringen. Die Studie […]
Sicher haben Sie das auch schon ab und zu mal gesagt. „Sorry, nicht mein Tag heute!“. Der Wecker hat aus einem unerfindlichen Grund nicht geklingelt. Sie stehen auf und fallen erst mal über die Hausschuhe vor dem Bett. Das Bad ist natürlich besetzt. Die Hose, die Sie anziehen wollen, ist ungebügelt. Andere Hose, Hemd an. […]
Der Gedanke, dass jeder Mensch nur aufgrund seines freien Willens agiert, ist sehr alt. Dieses Gebiet wird seit Jahren intensiv erforscht und immer wieder neu beurteilt. Umso erstaunlicher ist, dass die neuesten Forschungsergebnisse zu dem Schluss kommen, dass so etwas wie der freie Wille offenbar nicht existiert. Zu diesem Ergebnis kamen Hirnforscher nach ausführlichen Studien und vielen dementsprechenden […]
Was mehr nach esoterischem Unsinn klingt, wird nun auch wissenschaftlich belegt: die Jahreszeit, in der wir geboren werden, entscheidet darüber, welches Temperament wir aufweisen. Sommerkinder seien demnach eher Stimmungsschwankungen unterworfen als Winterkinder. Auch Krankheiten lassen sich laut dem Psychologen Helmuth Nyborg anhand der Jahreszeiten gruppieren. Kinder, die im Frühling geboren worden sind, leiden beispielsweise seit […]
Es geht dieser Tage durch alle Medien: Der Nationalspieler Luis Suarez beißt einem Spieler der gegnerischen Mannschaft in die Schulter. Und das war keineswegs eine Einzeltat, sondern kam schon geschlagene zwei Mal in seiner Karriere als Fußballspieler vor. Fußball kann bei Spielern zu höchsten Emotionen führen. Auch der National-Torwart Oliver Kahn biss dem Dortmunder Spieler Heiko Herrlich […]
Wenn es um gutes Aussehen geht, scheiden sich häufig die Geister. Bei der Gesichtsbehaarung von Männern ist das laut aktuellen Studien jedoch nicht immer der Fall. Eine Studie an der Universität in New South Wales in Australien ist genau dieser Frage nachgegangen: Wie sexy ist Gesichtsbehaarung bei Männern? Und kam zu mehreren überraschenden Ergebnissen. Im […]
Ein Hehl aus seiner Erkrankung hat Ned Vizzini nie gemacht: Offen sprach der viel beachtete Schriftsteller aus New York über seine Depression und schrieb sogar mit „Eine echt verrückte Story“ (Originaltitel: „It’s Kind of a Funny Story“) einen Roman, der auf den Erfahrungen während eines fünftägigen Aufenthalts in der Psychatrie beruhen. Am 19. Dezember 2013 nahm sich […]
Der römische Dichter und Philosoph Seneca schrieb einst: “Die meisten wissen nicht, was sie wollen, außer in dem Augenblick, wo sie wollen.“. Das könnte im Moment auch auf Barack Obama zutreffen. Aber nicht, weil er nicht weiß was er will, sondern im Gegenteil: In den letzten Tagen zeigte Barack Obama deutlich, was er nicht will: Assads Giftgasangriff auf […]
Depressive Erkrankungen tangieren inzwischen den Alltag eines jeden Menschen. Auch in zahlreichen Filmen, Büchern, Ausstellungen und Serien werden sie thematisiert. Oftmals wird auf diese Weise versucht die Situation des Erkrankten näher zu bringen und diese „andere Welt“ anschaulich und möglichst wahrheitsgetreu darzustellen. Doch wie gut gelingt das eigentlich, sprich wie realistisch ist die Darstellung von […]
Der Kampf der Stars mit Drogen, Alkohol oder Depressionen 2011 starb die Musikerin Amy Winehouse an einer Alkoholvergiftung – mit gerade 27 Jahren. Und damit ist sie leider nur ein Beispiel unter vielen, das zeigt: Ein Leben als Star in Glanz und Glamour ist keine Garantie für ein sorgenfreies Leben. Meist ist der Trubel um die eigene […]
Vor knapp zwei Wochen ging es durch die Medien: Das Liebes-Aus zwischen dem Hot Banditoz-Sänger Silva Gonzalez und Eli Bülowius. Beim Promi-Dinner hatte er zu offen und zu intensiv mit Lady Bitch Ray geflirtet. Jetzt ließ er sich aus eigenen Stücken in die Psychiatrie einweisen – Depressionen und Suizidgedanken. Depressionen sind nicht so selten, wie man annehmen […]