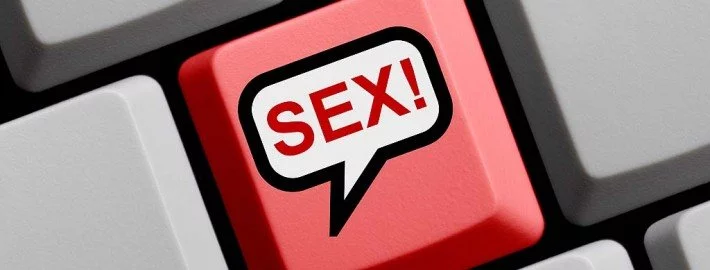Ein Projekt zur Prävention der Medizinischen Hochschule Hannover soll Personen weiterhelfen, die potenziell dazu bereit wären, jemanden zu vergewaltigen. Ihnen soll beigebracht werden, ihre sexuellen Impulse besser zu kontrollieren. Im neuen Forschungsprojekt des Arbeitsbereiches Klinische Psychologie und Sexualmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untersuchen Experten die Themen Behandlung und Prävention. Dabei geht es vor allem um dysregulierte […]
Schlagwortarchiv für: Sexualstörung
Du bist hier: Home » Sexualstörung
Beiträge
Transsexualität gilt in fast allen Ländern der Welt als psychische Krankheit, in Dänemark ist das jetzt nicht mehr der Fall. Wird die Weltgesundheitsorganisation Dänemark folgen? Nichts ungewöhnliches und schon gar nicht eine Krankheit, so steht Dänemark mittlerweile zur Transsexualität. Wer mit dem falschen Geschlecht geboren wird hat das Recht eine Veränderung zu wollen. Zum 1. […]
Es gibt praktisch nichts, was nicht zum Objekt der sexuellen Begierde werden kann. So sind, in entsprechenden Kreisen, getragene Socken oder Latexhosen ebenso begehrt wie Luftballons oder Windeln. Lange Zeit über galten die sexuellen Vorlieben von Fetischisten als pervers. Auch heute noch gilt der Fetischismus unter vielen eher konservativen Fachleuten als Störung der Sexualpräferenz. Die […]
Sex durch Drogen verbessern wollen. Dieser gefährliche Trend ist jetzt auch in Rhein-Main angekommen. Um ein stärkeres Hochgefühl zu bekommen, werden Drogen wie Ketamin, Crystal Meth und Liquid Ecstasy genommen – und damit rutschen die Konsumenten in einen gefährlichen Teufelskreis. Gerüchte und die Suche nach dem ultimativen Sex-Kick locken immer mehr Menschen an, chemische Substanzen […]
Ein rosa Pille unter dem Namen Addyi, jedoch besser bekannt unter dem Spitznamen „Viagra für Frauen“ kommt nun auf den US-amerikanischen Markt. Viele Gynäkologen sind jedoch eher skeptisch und warnen vor dem neuen Arzneimittel. Bereits zweimal hatte die Firma von Addyi versucht eine Genehmigung für den US-Markt zu erlangen, zweimal war sie gescheitert, im August […]
Jeden Tag gibt es etwa 40 Kinder in Deutschland, die sexuell missbraucht werden. Diese Zahl entspricht lediglich den offiziellen Daten aus der Kriminalstatistik. Ein deutsches Forschungsprojekt zeigt nun die Ausmaße dieser furchtbaren Taten und auch wie Prävention aussehen kann und sollte. Deutsche Psychologen und Mediziner aus Regensburg, Bonn, Hamburg, Ulm und Dresden haben sich dem […]
In der Psychologie wird die Nekrophilie als abweichendes menschliches Sexualverhalten betrachtet. Der Name kommt aus dem griechischen und bedeutet nekros= Tod und phil= Liebe. Diese Form des Sexualverhaltens kommt überwiegend bei Männern vor. Sie nutzen Leichname sowie leblose Körperteile als Objekt zur sexuellen Befriedigung. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden erstmals psychiatrische Forschungsarbeiten darüber verfasst. Den […]
Online Sexsucht – Fallzahlensteigerung liegt nah! Rund 500.000 Menschen sind in Deutschland – einer Schätzung folgend – sexsüchtig. Wurde früher der natürliche Sexualpartner aufgesucht, so ist heute vermehrt die Online-Sexsucht anzutreffen. Genaue Zahlen sind hierfür nicht vorhanden. Dennoch ist zu erwarten, wie Experten betonen, dass die Zahl der Betroffenen in der Vergangenheit stark anstieg. Auch […]
Der Begriff Pädophilie ist schon seit mehr als einem Jahrhundert gebräuchlich. In der Vergangenheit wurde die Pädophilie oft nur allein von der strafrechtlichen Seite aus gesehen. Bestenfalls beschäftigen sich Forensiker oder die Anstalten für derartige Straftäter damit. Der Begriff Pädophilie stammt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich „Kinderliebe oder Liebe zu Kindern“. Dies entspricht natürlich […]
Gesunde Wirkung der Sexualität Nach neuen Studien schützt regelmäßiger Sex den Mann vor Arterienverkalkung, Osteoporose, Herzinfarkt und Krebs. Beim Sex steigt der Testosteronspiegel an, was die Gedächtnisleistung verbessert und zudem das Risiko für Schlaganfälle vermindert. Schmerzen nehmen durch Substanzen ab, die opiumähnlich sind und somit wird Stress zuverlässig minimiert. Und auch die Bindung zwischen den […]
Sex – Es muss nicht immer eine Sucht sein Die Sexsucht kann in die normalen nicht-stoffgebundenen Süchte eingeordnet werden. Daher sind die Ursachen mit der Spielsucht und ähnlichen Problemen durchaus vergleichbar. Grundsätzlich handelt es sich nicht um einen einzigen Auslöser. Vielmehr müssen viele verschiedene Faktoren zusammenspielen, damit eine Sucht überhaupt ausgelöst werden kann – auch […]
Die Konsequenzen sind umfassend Die Sexsucht ist nicht nur emotional und körperlich belastend. Vielmehr zieht sie sowohl soziale wie auch finanzielle Folgen nach sich. Dies ist ein Resultat der Natur dieser Problematik, die nach wie vor gesellschaftlich ein Tabu ist. Die Folgen können alle Lebensbereiche betreffen und führen sehr häufig zu strafrechtlichen Konsequenzen – auch […]
Keine Spezialisten & begrenzte Möglichkeiten Sexsucht (Hypersexualität) ist noch immer eine Erkrankung, die eher tabuisiert wird. Im Vergleich zu anderen Süchten ist sie zudem noch wenig erforscht. Selbst in umfangreichen Standardwerken der Psychiatrie ist sie nur selten als eigenes Kapitel zu finden und wird am Rande unter den sexuellen Störungen abgehandelt. Diese Umstände führen dazu, […]
Es ist noch immer ein gesellschaftliches Tabuthema: die Unlust am Sex. So freizügig wie in den Medien auch über sexuelle Umstände berichtet wird, so tabuisiert wird die Verneinung von sexuellem Kontakt. Laut einer aktuellen Studie aus Sachsen-Anhalt, die mehr als 4500 Probandinnen befragte, haben sechs von zehn Frauen Probleme mit ihrer Sexualität. Gleichzeitig werden diese […]
Als asexuell bezeichnet man Personen, denen das sexuelle Verlangen fehlt, die also keinen Sex brauchen oder möchten. Asexualität kann aber gleichzeitig sehr facettenreich sein. Anja ist 28 Jahre alt und asexuell. Bereits im Teenager Alter stellte sie fest, dass sie sich deutlich weniger für Jungen und Sex interessierte als ihre Klassenkameradinnen. Zwischenzeitlich war sie dann […]
Das Thema Therapie bei Pädophilen ist seit der Affäre um den SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy wieder in aller Munde. Der Umgang mit der psychischen Krankheit Pädophilie wird seitdem rege diskutiert. Zunächst einmal sollte man sich allerdings darüber im Klaren sein, wann Pädophilie überhaupt als psychische Krankheit definiert werden kann. Die Krankheit Pädophilie Der Begriff Pädophilie meint im […]