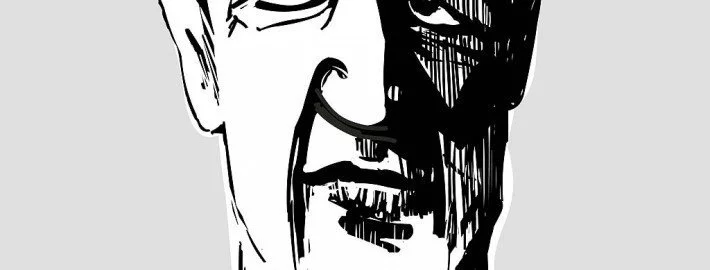Autistische Menschen unterscheiden sich in ihrem Verhalten grundsätzlich stark von ihrer Umwelt. Auffällig ist, dass offenbar mehr Männer und Jungen unter dieser Krankheit leiden als Frauen und Mädchen. In der Regel wird Autismus meist bereits im Säuglings- und Kleinkindalter festgestellt. Symptome Autisten sind kaum in der Lage Blickkontakt zu ihren Mitmenschen aufzunehmen. Sie lächeln nicht […]
Schlagwortarchiv für: Krankheitsbild
Du bist hier: Home » Krankheitsbild
Beiträge
Viele haben wohl schon einmal von der Diagnose Autismus gehört. Fragt man, wie sich die Krankheit äußert können doch nur wenige antworten. Die Krankheit, die statistisch gesehen mehr Jungen als Mädchen betrifft, wird zumeist schon im Kindesalter erkannt. Eine autistische Störung ist eine tiefgreifende Störung der Entwicklung. Der Psychologe Leo Kanner berichtete erstmals von der Störung. Das […]
Etwa drei Millionen Deutsche sind betroffen: Fibromyalgie. Schmerzen an wechselnden Stellen, Schlafstörungen, Abgeschlagenheit – aber keine echte Diagnose. Häufig werden die Erkrankten – selbst von ihrem Arzt – nicht ernst genommen und als Hypochonder und eingebildete Kranke abgestempelt. Dass vier bis sechs Mal mehr Frauen als Männer betroffen sind, stützt diese These in den Augen der […]
Hypochonder werden oft als „eingebildete Kranke“ bezeichnet und dementsprechend belächelt. Es gibt wohl kaum eine psychische Störung, die so bekannt ist, wie die Hypochondrie. Dabei ist eine echte Hypochondrie eine ernst zu nehmende Störung und kann für den Betroffenen eine echte Qual bedeuten. Die hypochondrische Störung zählt zu den sogenannten somatoformen Störungen. Typisch für das Krankheitsbild ist, dass […]
Bei allen psychischen Erkrankungen gibt es eine Fülle von Ausprägungen. Dies trifft ganz besonders auf das Krankheitsbild der Psychose zu. Hier können fremdartige oder beängstigende Erfahrungen einen Krankheitsschub auslösen. Es kann in der Folge zum Verlust der Orientierung, Trugwahrnehmungen oder Wahnvorstellungen kommen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben Ärzte und Forscher viele Schritte unternommen, um die […]
Das sogenannte weiße Rauschen, das Schizophrenie-Patienten das Leben schwer macht, ist bislang noch nahezu unerforscht. Es deutet allerdings auf eine Überbelastung im Gehirn hin. Eine Studie hat sich diesem Symptom nun angenommen und hofft die psychische Erkrankung Schizophrenie dadurch verständlicher zu machen. Die Studie im Detail Die Forscher der Columbia University bezogen 36 Probanden in […]