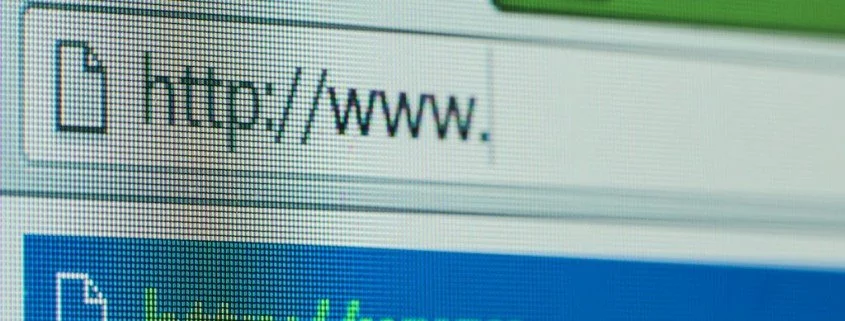Beinahe drei Viertel aller Frauen wurden bereits Opfer von Cyber-Gewalt. Dies geht aus einer Studie der UN-Breitbandkommission hervor. Nun fordert die EU-Webseitenbetreiber und Regierungen auf, verstärkt gegen Bedrohungen und Belästigungen im Internet vorzugehen. Kürzlich wurde ein UN-Report veröffentlicht, der sich mit der Problematik der Cyber-Gewalt befasst und Forderungen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und […]
Schlagwortarchiv für: Frauen
Du bist hier: Home » Frauen
Beiträge
Viele Männer können eine Frau nicht weinen sehen. Ihre Tränen wecken den männlichen Beschützerinstinkt und die meisten Herren der Schöpfung tun alles, um den weiblichen Tränenfluss zu stoppen oder erst recht, ihn zu verhindern. Warum in den Männern beim Anblick von Frauentränen der Kavalier erwacht, wissen sie allerdings selbst nicht so genau. Nicht jeder kennt […]
Frauenquote – Chancengleichheit – Gleichberechtigung – sind häufig diskutierte Themen, wenn es um die Besetzung von Stellen in den Chefetagen geht. Während es einige überzeugend wirkende Argumente für die gesetzliche Einführung einer Frauenquote für höher dotierte Stellen gibt, plädieren Andere sowohl an die Einsicht bei Personalchefs, dass Frauen ebenso qualifiziert sind, wie Männer und daher […]
Während eines Kongress über Männergesundheit und psychische Gesundheit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) teilte die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) einige Erkenntnisse mit der Öffentlichkeit. Dazu gehörte die Beobachtung, dass sich bei Männern psychische Erkrankungen häufig durch andere Anzeichen und Symptome zeigen als bei Frauen. Das führe dazu, dass […]
Es ist bereits bekannt, dass Frauen vor der Regel Stimmungsschwankungen haben können oder eine gesteigerte Lust auf Sex wenige Tage vor dem Eisprung. Doch nun liegen neue Erkenntnisse zum Zyklus und Hormonspiegel der Frau vor. Wie groß ist die Kooperationsbereitschaft von Frauen während der Menstruation? An der Goethe-Universität haben Psychologen nun den Zusammenhang von Kooperationsbereitschaft […]
Bereits seit Anfang des letzten Jahrhunderts begehen Menschen rund um die Welt am 8. März den Weltfrauentag, um sich für mehr Gleichberechtigung und weniger Gewalt gegen Frauen einzusetzen. Nach über hundert Jahren stellt sich nun die Frage, wie es heute mit der Gleichberechtigung aussieht. Sind Frauen heute wirklich gleichberechtigt? Auch die Frage, wie sich das […]
Seit über 100 Jahren feiern Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt den „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frauen und den Weltfrieden“, kurz den Weltfrauentag. Jedes Jahr am 8. März fordern Aktivistinnen auf verschiedenen Events Gleichberechtigung für Frauen und demonstrieren gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen. Geschichtliches „Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte“ forderte […]