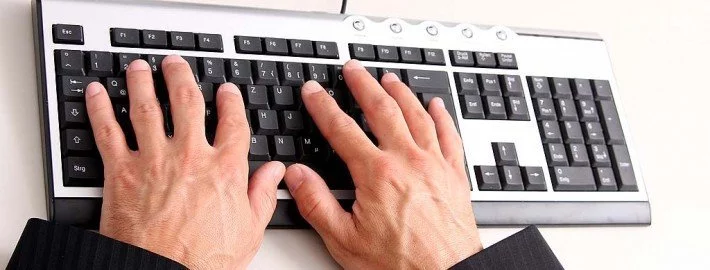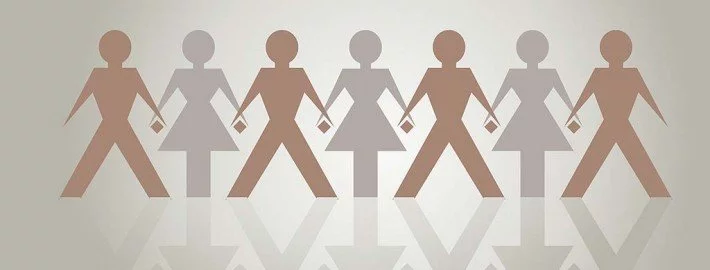Es gibt wohl kaum noch einen Haushalt, in dem sich nicht mindestens ein Computer befindet. In vielen Fällen wird der Rechner sicherlich für die berufliche Fortbildung genutzt. Die meisten Menschen binden den PC jedoch aktiv in ihre Freizeitgestaltung, beispielsweise in Form von Computerspielen, ein. Dies hat zum Teil gravierende Folgen für das soziale Leben seiner […]
Schlagwortarchiv für: Computer
Du bist hier: Home » Computer
Beiträge
Durch die modernen Medien ist eine starke Zunahme von Süchten zu bemerken. Vor allem die Computerspielsucht ist auf dem Vormarsch und betrifft sehr häufig Kinder und Jugendliche. Die Folgen der Sucht können gravierend sein. Dennoch kennen die Wenigsten die Mechanismen und Auswirkungen, die zur Sucht führen. Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen Bei der Computerspielsucht handelt […]
Die Kinderzimmer sind voll von Technik. Computern, Fernseher und Co. begleiten die Kinder heute durch ihre Kindheit. Daher erscheint es den Eltern sehr oft als gute Möglichkeit, diese auch als Strafe für ein Fehlverhalten zu instrumentalisieren. Ein Fehler, denn damit werden die Grundsätze einer guten Pädagogik missachtet. Wirksam und dennoch nicht sinnvoll Zwar hat heute […]
Kennen Sie den Film „A beautiful mind“ mit Russell Crowe? Sehr sehenswert. Er zeigt die Lebensgeschichte des insbesondere für die Spieltheorie bekannten Mathematikers John Forbes Nash Jr. Während seines Studiums wird bei ihm Schizophrenie diagnostiziert, die ihn immer tiefer in den Wahn führt, dass er in geheimem Auftrag der amerikanischen Regierung Codes sowjetischer Agenten entschlüssele. Nash wird […]
Dass Computerspiele oder Simulatoren im Allgemeinen den Charakter und die Handlungsbereitschaft von Menschen beeinflussen können, ist längst bekannt. Bislang zeigten die Studien immer wieder, dass sich diese Beeinflussung vor allem bei Jugendlichen negativ äußert. Doch gibt es nicht auch in diesem Fall eine Kehrseite der Medaille? Ist es möglich statt Waffen und Gewalt in der […]