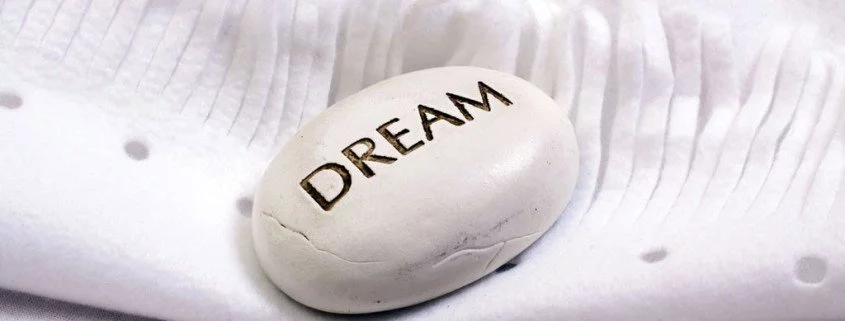Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied und für jeden Menschen gestaltet sich Glück auf unterschiedliche Weise. Manche empfinden die Lektüre eines guten Buches als pures Glück und wieder Andere brauchen das Abenteuer, um Glücksgefühle zu empfinden. Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde hat die Vorteile eines eigenen Gartens zusammengefasst und bezeichnet ihn als Glücksbringer im wahrsten Sinne […]
Archiv für die Kategorie: Psychologie im Alltag
Du bist hier: Home » Psychologie im Alltag » Seite 11
Psychologie im Alltag
Viele Autofahrer können auch während des Fahrens nicht auf ihr Mobiltelefon verzichten. Jeder weiß, dass es unvernünftig ist und teuer werden kann, wenn man während des Fahrens mal eben eine SMS verschickt oder ohne Freisprechanlage telefoniert – trotzdem nimmt die Handynutzung während des Fahrens nicht ab. Neben dem Handy sorgt aber auch die Bedienung des […]
Verschwörungstheorien werden gerne belächelt bis ihre Stichhaltigkeit bewiesen ist. Halluzinationen gelten zumeist als Nebenwirkung oder Krankheitserscheinungen. Aber wie ist es eigentlich mit Menschen, die das Abbild von Jesus Christus auf einer Toastscheibe sehen? Warum sehen Menschen manchmal Dinge oder Personen, die nicht da sind? Jesus auf der Toastscheibe Im religiösen Amerika ist es fast schon […]
Um es gleich vorweg zu nehmen: Natürlich ist eine akute Migräne-Attacke nicht hilfreich, um irgendwelche Probleme zu lösen. Wer unter der Krankheit leidet, weiß gut genug um die Einschränkungen während einer Anfalls. Allerdings ging die Medizin bisher davon aus, dass Migräne-Patienten bei der Lösung von Problemen eher langsamer sind als andere. Neue Forschungsergebnisse jedoch belegen das […]
Oftmals werden besonders schönen Menschen auch vermehrt gute Charakterzüge zugeschrieben. So scheinen sie außerordentlich intelligent oder sympathisch zu sein oder sehr zielstrebig und erfolgreich. Doch entspricht dies wirklich der Realität? Die selbsteingeschätzte Attraktivität kann jedoch, wer kennt das nicht, nach Tagesform, Gesundheitszustand und dem jeweiligen Selbstwert variieren. Es ist laut Studien sogar eher so, dass Menschen, die […]
Die Sonne scheint, Kinder tollen auf der Wiese und man hat ein gutes Buch vor sich liegen. Sind dies echte Glücksmomente? Viele Menschen fragen sich, was sie tun müssen, um wahrhaftig glücklich zu werden. Vielleicht keine Gebrauchsanweisung, aber doch einen Leitfaden konnten die Mitarbeiter der „Happiness Research Group“ an der Jacobs University in Bremen herausarbeiten. Die […]
Sowohl was unsere Arbeit als auch unser Privatleben betrifft, versuchen wir unaufhörlich unserem Verhalten und unserer Umgebung Sinn abzugewinnen. Die Erfahrung von sinnhaftem Handeln ist eng mit der psychischen Gesundheit eines Jeden verknüpft. Nur dann, wenn wir Sinnhaftes tun, können wir unser Leben glücklich und zufrieden leben. Doch was ist eigentlich der Sinn des Lebens? […]
Mit diesem Artikel startet unsere dreiteilige Serie zum Thema „Halluzinationen“. Der vorliegende Text soll Sie darüber informieren, welche Arten von Halluzinationen es überhaupt gibt und wie man diese voneinander unterscheiden kann. Im nächsten Teil der Serie werden wir genauer auf die zugrundeliegenden Ursachen und Krankheitsbilder eingehen, aus denen Halluzinationen resultieren können. Der letzte Artikel wird schließlich […]
Dass uns die Meinung anderer so sehr interessiert wie noch nie, können wir nicht abstreiten. Der neuste Trend bestimmt nicht nur, welche Schuhe wir tragen, sondern auch Form und Farbe unserer Unterwäsche. Sie mögen kein Rot? Nun ja, es ist dieses Jahr Trendfarbe, sagen die anderen – und schon kommt es uns ein wenig sympathischer […]
Träumen wird oft etwas mystisches oder paranormales zugeschrieben- versucht man sich über Träume und Traumsymbole zu informieren, stößt man oft auf Eingebungstheorien oder Signale aus einer fremden Welt. Manche erhoffen auch eine geheime Wahrheit über sich selbst in ihrem Unterbewussten zu erkennen, so wie das Sigmund Freud in seiner Traumdeutung interpretierte. Heutzutage interpretieren Traumforscher Träume jedoch […]
Besonders im beruflichen Umfeld ist Kritik sehr verbreitet. Kritik kann sowohl konstruktiv, als auch destruktiv ausgefallen. Letzteres bedeutet, dass die Kritik nicht objektiv motiviert ist und vor allem unsachlich vorgetragen wird. Daher ist es wichtig, dass man selbst unterscheiden kann, um welche Art Kritik es sich jeweils handelt. Dennoch haben viele Menschen ein großes Problem damit, selbst […]
Jeder Mensch ist einzigartig. Das bezieht sich nicht nur auf seine physische Struktur, sondern auch auf seine Psyche, seine Persönlichkeit, seine Fähigkeiten, seine Art zu denken und zu empfinden. Nicht einmal eineiige Zwillinge sind hinsichtlich ihre Physis oder ihrer Persönlichkeit identisch. All dies fassen wir in einem Begriff zusammen, wenn wir von Individualität sprechen. Doch was ist […]
Das Medienecho bezüglich der NSA-Affäre ist groß und die Empörung unüberhörbar. Die Geschichte rund um Edward Snowden und seine Enthüllungen wird nun verfilmt. Die politischen Reihen jedoch verhalten sich noch immer verhältnismäßig ruhig und auch den deutschen Durchschnittsbürger scheint nichts so schnell aus der Ruhe zu bringen. Die Reaktion der Bevölkerung und die rechtlichen Hintergründe der Spionage […]
Als Zeitmanagement bezeichnen wir Planungs- und Arbeitstechniken, welche uns zu einem bestimmten Ziel führen. Beispielsweise die Vereinbarung der anstehenden Termine oder die Strukturierung von unterschiedlichen Aufgaben in einem bestimmten Zeitraum. Besonders in Anbetracht der stressbedingten Erkrankungen, welche heutzutage immer häufiger auftreten, werden Methoden zur Vermeidung von negativem Stress anhaltend gefragter. In Vorträgen und Kursen wird anhand von mehr oder […]
„Geld allein macht auch nicht glücklich“, so sagt ein geflügeltes Wort. Und Studien bestätigen diese Aussage. Nun sind „Glück“ und „Glücklichsein“ ohnehin recht subjektive Werte. Was einen Menschen glücklich machen kann, bedeutet dem anderen gar nichts. Glück wird meist verstanden in Verbindung mit Wohlergehen und Zufriedenheit . Doch nur, weil man sich wohl fühlt oder zufrieden […]
Der Sommer ist da – und nachdem er sich zunächst ebenso zu verspäten schien wie das Frühjahr, erwarten manche Meteorologen nun sogar rekordverdächtige Sonnenpräsenz. Das sollte man unbedingt nutzen! Sonnenlicht ist für uns Menschen wie für die größte Zahl der uns bislang zugänglichen Organismen von enormer Bedeutung. Wie erst vor wenigen Jahren erforscht wurde, besitzen wir in unseren […]
Eifersucht gehört fest zum menschlichen Verhalten dazu. Es ist eine normale Reaktion, dass beispielsweise die Frau eifersüchtig wird, wenn der Mann offenkundiges Interesse an einer anderen Dame offenbart. Männer sind vor diesen Gefühlen ebenfalls nicht befreit. Interessant ist jedoch, dass die meisten Menschen scheinbar in der Lage sind, das eigene Selbstbild flexibler zu gestalten, wenn der […]
Freundschaften sind immer Gold wert, sie bereichern unser Leben und steigern damit die Lebensqualität. Der wahre Wert einer Freundschaft zeigt sich vor allem dann, wenn es Probleme gibt und man den Rat oder die Hilfe eines Freundes benötigt. Erst in schwierigen Zeiten zeigen sich die wahren Freunde. Viele haben zwar einen großen Freundeskreis, aber oft sind […]
Kennen Sie TV-Sendungen wie „Stromberg“ oder „Deutschland sucht den Superstar“? Diese und ähnliche Formate haben dem Wort „Fremdschämen“ eine ganz neue Tiefe gegeben. Finden Sie nicht auch? Im Jahr 2009 wurde das Wort „Fremdschämen“ in den Duden übernommen und 2010 hat es Österreich zum Wort des Jahres gewählt. (Nur so nebenbei – in Deutschland war […]
Irren ist menschlich, das gilt auch für die Beurteilung von Fremden. Nicht jeder und jedem ist das gegeben, was man als „Menschenkenntnis“ bezeichnet. Die Fähigkeit, den Charakter einer anderen Person schnell, nach Möglichkeit schon im ersten Moment der Begegnung zu erfassen, basiert auf Erfahrung, guter Beobachtungsgabe und nicht zuletzt auf Intuition und Selbstbewusstsein. Sie hat […]