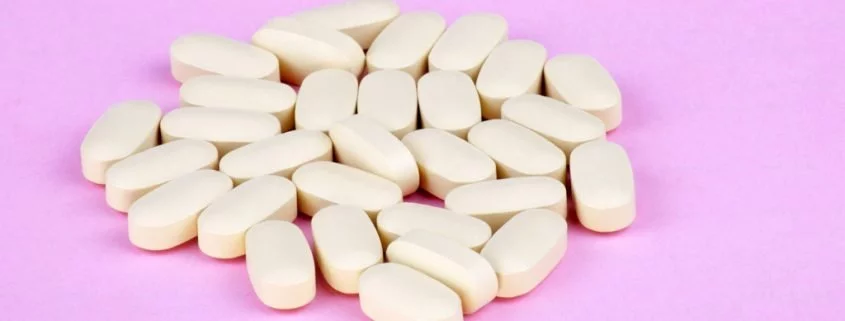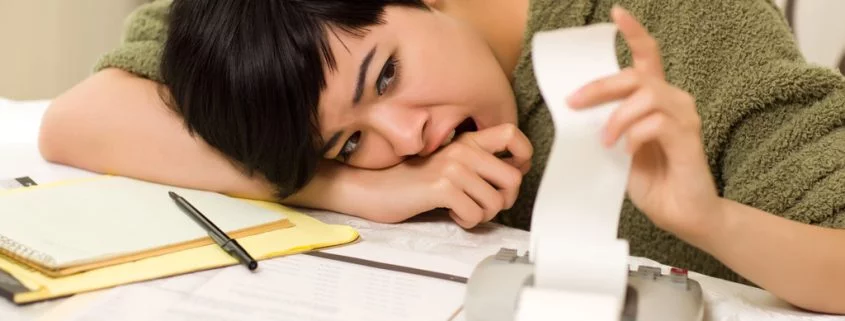Transsexualität gilt in fast allen Ländern der Welt als psychische Krankheit, in Dänemark ist das jetzt nicht mehr der Fall. Wird die Weltgesundheitsorganisation Dänemark folgen? Nichts ungewöhnliches und schon gar nicht eine Krankheit, so steht Dänemark mittlerweile zur Transsexualität. Wer mit dem falschen Geschlecht geboren wird hat das Recht eine Veränderung zu wollen. Zum 1. […]
Archiv für die Kategorie: News & Storys
Du bist hier: Home » News & Storys » Seite 6
Psychologie News & Storys
Wenn Kunstexperten ein Kunstwerk in den Himmel loben, gefällt es uns oftmals ebenfalls. Wissenschaftler führten an der Universität Wien eine Studie durch und stellten fest, dass unser Kunstgeschmack in den meisten Fällen nicht nur von persönlichen Vorlieben, sondern auch in hohem Maße von sozialen Aspekten abhängig ist. Jeder hat seinen eigenen Geschmack Geschmäcker sind bekanntlich […]
Allein in Deutschland entstehen jährlich Milliardenschäden durch Verbrechen. Unethisches Verhalten, also zum Beispiel Diebstahl, Betrug und Bestechung, sieht man überall und zu jeder Zeit. Menschen werden zu Tätern, weil sich die Gelegenheit anbietet und der moralische Kompass nicht funktioniert. Private Post über die Firma verschicken? „Der Chef merkt das sowieso nicht und ich spare Geld. […]
Ein Patzer! Und das auf einer großen Bühne und vor Millionen von Menschen. Das passierte Patti Smith bei der Nobelpreisverleihung, als sie ein Lied von Bob Dylan sang, einen ehemaligen Freund von ihr. Musikern fällt es auch nicht immer leicht vor einem Publikum die Nerven zu behalten, allerdings kann das Publikum ihnen dabei auch behilflich sein. […]
Egal ob in einem Straßencafé oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, oftmals macht es uns Spaß, andere Menschen zu beobachten. Häufig fühlen wir uns dabei insgeheim etwas beschämt, dabei ist dies ein Verhalten, das die Mehrheit der Menschen an den Tag legt. Wir fühlen uns unbeobachtet Wenn wir alleine in der Straßenbahn sitzen und andere Personen beobachten, […]
Die gute alte Zeit! Früher war alles besser! Als ich noch in Deinem Alter war…! Viele meinen, die Vergangenheit sei um einiges besser gewesen und schwelgen in schönen Erinnerungen. Aber stimmt das wirklich? Julia Shaw, Psychologin, betitelt diesen Effekt als Verklärung der Vergangenheit. Ob in der Politik, in der Mode oder in der Musik, Nostalgie […]
Beim Tanzen geht es um Gefühl, um Ausdruck und darum eine Geschichte durch die Bewegungen seines Körpers zu erzählen. US-Amerikanische Wissenschaftler gehen daher in Folge einer Studie davon aus, dass Tänzer ein höheres Maß an Empathie an den Tag legen, als die meisten Menschen. Tanzen als Ausdruck der Seele Das Tanzen offenbart Einblicke in unsere […]
Damit Politiker ihre Ziele erreichen können, bedienen sie sich spezifischer sprachlicher Mittel. Besonders wichtig wird hier das sogenannte „Ideologievokabular“, welches Bezeichnungen meint, die Wertevorstellungen und Denkmuster einer politischen Gruppierung beschreibt. Ideologie wird dabei eher wertneutral verstanden. Im Alltag wird der Begriff sonst zumeist so aufgefasst, dass jemand die Wahrheit verzerrt oder falsch darstellt. Es selbst […]
Verhaltensforscher haben jetzt herausgefunden, dass Ratten lachen können – für den Menschen nur unhörbar. Dazu kommt, dass auch Rattenweibchen Wert auf Humor bei ihren männlichen Partnern legen. Menschen können das Lachen nicht hören, da es mit 50 Kilohertz zu hoch ist. Forscher können die Laute durch akustische Geräte hörbar machen – es hört sich nach […]
Mit dem warmen Wetter setzen bei einer Vielzahl von Menschen Jahr für Jahr auch die Frühlingsgefühle ein. Sobald man dann den Angebeteten oder die Angebetete erblickt, machen sich Schmetterlinge im Bauch breit und das Herz fängt unkontrolliert an zu klopfen. Dies sind dabei noch die angenehmsten Reaktionen, die der menschliche Organismus auf das Verliebtsein zeigt. […]
Sarah Diefenbach ist Wirtschaftspsychologin und erklärt uns warum wir ständig auf unser Handy schauen, dadurch schlechte Umgangsformen haben und es nur noch winzige Sonnenuntergänge gibt. Frau Professor Diefenbach, obwohl jeder es kennt ändern wir nichts. Wir schauen ständig auf unser Handy, informieren uns über Instagram oder Facebook und wiederholen dies immer und immer wieder. Warum […]
Es ist ein sehr schlimmes und tragisches Ereignis wenn das eigene Kind stirbt, doch das Leben geht weiter. Eltern müssen dann lernen mit der schwierigen Situation umzugehen. Dabei kann ein Ehepaar aus Hamburg helfen. Sie machen aus den Kleidern der Kinder einzigartige Puppen. Als besondere Erstlingsstücke leben die Kinder dann weiter. Für Jennifer Arndt-Lind ist […]
Nicht alle Menschen fühlen sich Rampenlicht bzw. im persönlichen Spotlight wohl. Anhand von verschiedenen Versuchsanordnungen versuchen Psychologen das menschliche Wesen zu ergründen. Barry Manilow muss zurzeit einiges über sich ergehen lassen. Ein Kaufhaus hat angekündigt, mit seiner Musik randalierende und störende Jugendliche zu vergraulen. In der Wissenschaft wurden Marilows Songs auch genutzt bei einem Experiment […]
Dass Liebe nicht nur in der Literatur und der Poesie immer einen Ausweg findet, konnten jetzt die Psychologen der Universitäten Jena und Kassel belegen. Das gilt besonders für neurotische Menschen, die im hohen Maße von einer romantischen Partnerschaft profitieren. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand der Neurotizismus. Dieser zählt laut Psychologen zu den fünf Grundeigenschaften der […]
Ist die Existenz des weiblichen Orgasmus ein Zufall? Evolutionsbiologen sind der Meinung, dass er bei Frauen eine wichtige Rolle für die Evolution gespielt hat. Während der sexuelle Höhepunkt beim Mann mit dem Ausstoß des Ejakulats zusammenhängt, beschäftigt sich die Wissenschaft schon seit langem mit der Rolle des weiblichen Orgasmus. Für die Reproduktion ist er schließlich nicht zwingend […]
Hoffnungsvoll und humorvoll erwartete man in den USA die erste Lustpille für die Frau. Die so genannte „Pink Viagra“ beinhaltet den Wirkstoff Flibanserin. Eine neue Richtlinie der amerikanischen Zulassungsbehörde bedeutete dann schon nach einem Jahr auf dem US-Markt das Aus für die kleine pinke Pille. Eine Chance auf eine Zulassung war bei diesen Regelungen sehr […]
Menschen, die wir kennen und schätzen, behandeln wir meist großzügiger und wir sind eher dazu bereit, zu teilen, als bei Unbekannten. Nun wurden durch ein Wissenschaftlerteam der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Bonner Universität sowie Züricher Forschern die Hirnregionen identifiziert, die für diese Variabilität in großzügigem Verhalten verantwortlich sind. Eine Auswirkung der Ergebnisse kann […]
Zur Zeit leiden bereits 350 Millionen Menschen unter einer Depression. Das bedeutet, dass fast jeder zehnte betroffen ist. Die Todesfälle bringen die Depression auf Platz vier der häufigsten Todesursachen. Schon 2020, so prognostiziert es die WHO, soll die Anzahl der betroffenen so weit ansteigen, dass die Depression oder affektive Störungen auf Platz zwei hochrutscht. Leidet […]
Im Jahr 2010 wurde Griechenland von der Finanzkrise überrollt. Aus Abwasseranalysen konnten Forscher nun herauslesen, wie sehr diese schwere Zeit auch die Psyche der Griechen betroffen hat. Wirtschafts- und Finanzkrise beutelt Griechenland Noch ist kein Ende in Sicht, noch steckt Griechenland bis zum Hals in der Finanzkrise, die seit 2010 die Wirtschaft des Landes lahmlegt. […]
Amerika hat gewählt. Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Psychologen sind sich bei der Analyse seiner Persönlichkeit äußerst uneins und stoßen teilweise an ihre ethischen Grenzen. Zahlreiche Ferndiagnosen durch Fachleute Der bekannteste amerikanische Experte für den Bereich Persönlichkeitsstörungen, Allen Frances, berichtete bereits im Wahlkampf, dass bei Donald Trump keine Spur einer psychischen […]