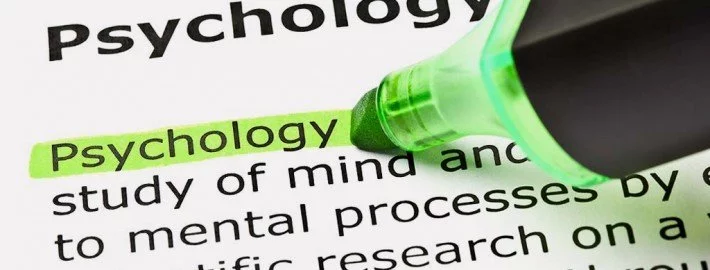Auf den Begründer der Psychoanalyse, Siegmund Freud, geht ein ganz bestimmtes Bewusstseinsmodell zurück: Das Eisbergmodell. Dieses ist Teil der Theorie der Persönlichkeit von Siegmund Freud. Was er beobachtete, führte ihn zu der Annahme, dass unser Handeln zu gerade einmal 20 Prozent davon bestimmt wird, wie wir uns im täglichen Situationen verhalten bzw. auf was wir in […]
Schlagwortarchiv für: Psychoanalyse
Du bist hier: Home » Psychoanalyse
Beiträge
Die Bilder aus Tinte, die verschiedene Formen darstellen und in der Fachsprache unter dem Namen „ Rorschach-Formen “ bekannt sind, wurden bereits zahlreich in der Behandlung von Patienten eingesetzt. Forscher haben nun eine Theorie entworfen, die erklären soll, warum einige dieser Formen besser wirken als andere. Rorschach-Formen offenbaren den seelischen Zustand Im Jahre 1921 entwickelte Hermann Rorschach, […]
Der Begriff Psychoanalyse setzt sich aus dem griechischen Wort für Seele (psyche) und Zerlegung (analysis) zusammen. Als Begründer der modernen Psychoanalyse gilt der Wiener Neurologe Siegmund Freud. Aus den Grundlagen seiner Lehre haben sich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe unterschiedlicher Strömungen innerhalb der Tiefenpsychologie entwickelt. Psychoanalyse, was ist das? Als Psychoanalyse gilt die Theorie über […]
Sigmund Freud kam im Jahre 1856 als Sohn eines Geschäftsmannes zur Welt. Freud lebte und arbeitete bis zur Besetzung durch Hitler in Wien und erforschte dort den komplexen Aufbau der menschlichen Psyche. Zu Beginn seiner Karriere forschte Freud am allgemeinen Krankenhaus Wien und beschäftigte sich zunächst mit Studien über das Zentralnervensystem des Menschen. Schnell galt er […]