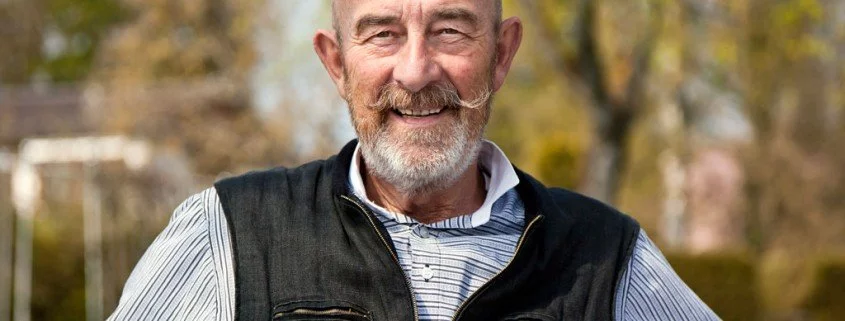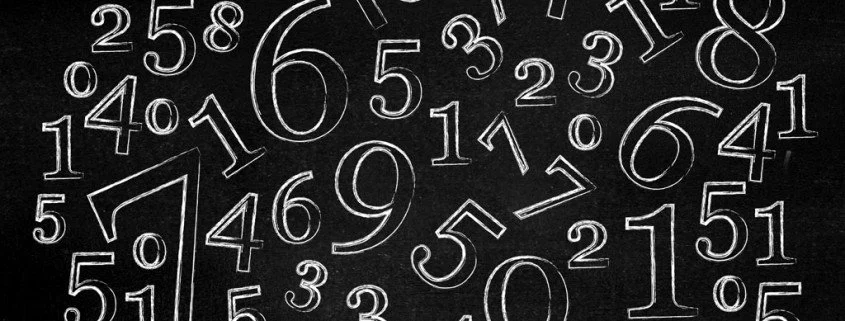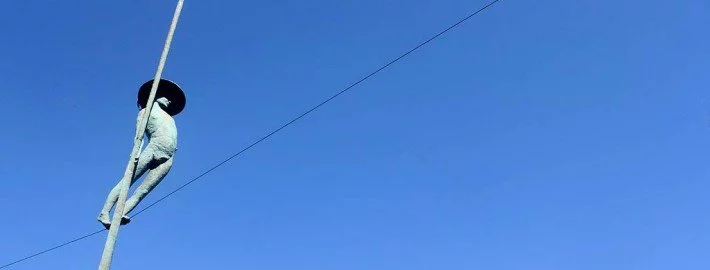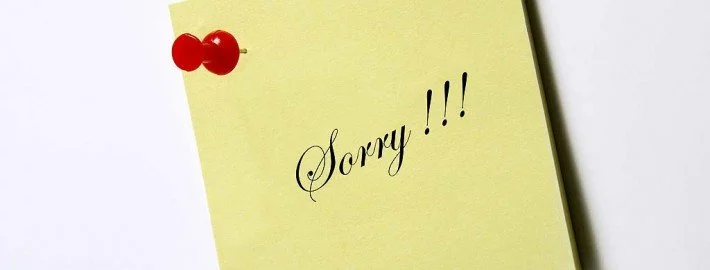Etwa drei bis fünf Prozent der Erwachsenen sind somnambul. Bei Kindern und Jugendlichen ist der Prozentsatz der Schlafwandler wesentlich höher. Etwa 15 Prozent der Fünf- bis 12-Jährigen waren schon mindestens einmal auf nächtlicher Tour. Nach vorne gestreckte Arme und steifes Herumstaksen – oft noch im Pyjama – und dann – nach einiger Zeit – kehrt der Schlafwandler […]
Archiv für die Kategorie: Psychologie im Alltag
Du bist hier: Home » Psychologie im Alltag » Seite 13
Psychologie im Alltag
Warum Freundschaften wichtig für unser Wohlbefinden sind Ausreden gibt es genug: Der anspruchsvolle und zeitaufwendige Job oder Familienverpflichtungen müssen oft herhalten, um vor sich und anderen zu rechtfertigen, warum man denn seine sozialen Kontakte nicht regelmäßig pflegt. Dass gerade dies jedoch entscheidende Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann, wurde bereits durch mehrere Studien belegt. Zum einen verändert […]
Es gibt eine ganze Reihe von Computerprogrammen, die sogenanntes Gehirnjogging anbieten. Glaubt man den Werbeversprechen der Hersteller, so sollen diese das „Gehirnalter“ senken und uns damit fitter im Kopf machen. Allerdings ergab eine große britische Untersuchung, dass diese Programme offenbar weitgehend nutzlos zu sein scheinen. Studien beweisen, Gehirnjogging steigert die geistige Leistungsfähigkeit nicht! Im Rahmen einer Studie […]
Stellen Sie sich vor, sie können sich aufgrund einer Verletzung – sagen wir, Sie haben sich das Bein gebrochen – nur im Rollstuhl fortbewegen. Sie möchten gerne mit dem Zug zur Arbeit fahren und müssen feststellen, dass es keine Möglichkeit gibt, an das Gleis zu gelangen. Es fehlt ein Aufzug. Menschen mit Behinderung – und damit sind […]
Wer kennt es nicht? Mitten in der Nacht wacht man scheinbar ohne Grund auf und kann einfach nicht wieder einschlafen. Man wälzt sich im Bett hin und her, steht vielleicht auf, um zur Toilette zu gehen und liegt einige Stunden wach. Wertvolle Zeit vergeht, in der man eigentlich doch schlafen wollte, um wieder fit zu sein für die […]
Wir kennen das Alle – unangenehme Aufgaben verschieben wir nur zu gerne auf morgen oder den Tag danach oder… Ein Teufelskreis ergibt sich, wenn beispielsweise im Studium Klausuren und Hausarbeiten ewig vor sich hingeschoben werden. Forscher haben nun das Gegenteil von der sogenannten Prokrastination entdeckt: Den Drang alles sofort zu erledigen, auch Präkrastination genannt. To-Do-Listen Schreiber Sie […]
Facebook regiert unsere soziale Welt. Um auf dem Laufenden zu bleiben, ist es fast unerlässlich einen Facebook-Account zu haben. Wie viele Freunde man dort hat, entscheidet darüber, wie beliebt man erscheint und wie viel Aktivitäten man von Anderen mitbekommt. Das kann aber auch schonmal zu Stress führen, wenn wir immer Teil des Lebens von unzähligen […]
Fast jeder kennt das Phänomen, oft hat man das Gefühl, dass man an manchen Tagen geistig einfach besser in Form ist. Ist das nur ein Gefühl, oder stimmt das tatsächlich? Dieser Frage wollte ein deutsch-schwedisches Forscherteam nun ein für alle Mal auf den Grund gehen. Ihren Ergebnissen nach gibt es tätsächlich Schwankungen bei der geistigen Leistungfähigkeit. Dass aber, wie […]
Die meisten Menschen bohren ab und an in der Nase. Aus gesellschaftlicher Sicht ist das eine Unsitte, ob Nasenbohren allerdings ungesund ist, darüber sind die Meinungen geteilt. In der Regel ist es so, dass der Finger in der Nase nur bei kleinen Kindern toleriert wird. Ein Erwachsener, der in der Nase bohrt, erntet zumindest kritische Blicke. Zudem […]
Haben wir die Möglichkeit unsere Gene und daraus resultierendeVerhaltensmerkmale zu beeinflussen, oder nicht? Wie hoch ist der Anteil von dem, was uns unsere Eltern vererbt haben und wie viel Bedeutung erhält die Erziehung und unser Umfeld in unserer persönlichen Entwicklung? Dass wir viele Bereiche unseres Lebens selbst in der Hand haben, scheint uns logisch, doch […]
Die Art und Weise wie man Zahlen darstellt haben scheinbar nichts mit ihrem eigentlichen Wert zu tun. Aber ist das wirklich so? Profis verwenden diese jedoch so gezielt, dass ein und dieselbe Zahl in den Augen des Betrachters dennoch einen höheren Wert darstellt. Der Duden empfiehlt „am Anfang eines Satzes Zahlenwerte auszuschreiben“ aber auch, dass man „ganze Zahlen kleiner […]
Wir Alle kennen das: Erblickt man einen bettelnden Obdachlosen an der Straße, wird einem erstmal bewusst wie gut man es im Leben eigentlich hat. Ein warmes Dach über dem Kopf ist mehr als Lebensbedingung und sollte für jeden Menschen gewährleistet sein. Leider ist dies allerdings nicht immer Fall und aus unterschiedlichen Gründen leben viele Menschen […]
In der heutigen Zeit dürfte es äußerst schwer fallen, sich dem Einfluss der Medien und sozialen Netzwerke wie Facebook zu entziehen. Mit ihnen haben Verhaltensweisen Eingang in unseren Alltag gefunden, die noch vor wenigen Jahren befremdlich gewirkt hätten. Eine solche Verhaltensweise ist das sogenannte Selfie, eine Art Selbstporträt, üblicherweise mit einer einem Smartphone auf Armeslänge […]
Ein jeder Mensch erfährt in seinem Leben einmal oder auch mehrere Male das Gefühl der Schuld. Möglicherweise ging diesem nagenden Gefühl ein Streit voraus, jemand wurde verletzt oder eine andere Tatsache führt zu diesem Gefühl. Da es so viele Menschen tagtäglich betrifft und weil es oftmals schwer zu händeln ist, wollen wir Euch im Folgenden […]
Die Gier nach sozialer Bestätigung Schon seit Urzeiten, in denen wir in Gruppen hinter großen Beutetieren her jagten, sind Menschen vor allem soziale Geschöpfe. Soziale Isolation kann uns brechen und seelisch, sowie körperlich krank machen. Im Gegenzug ist die soziale Anerkennung jene Kraft, die uns in unserem Innersten antreibt. Die uns dazu bringt, noch mehr im Job […]
Grübeln – ein Ausweg aus dem Teufelskreis Jeder beschäftigt sich hin und wieder einmal zu lange mit einem leidigen Thema wie der verhauenen Mathe-Arbeit oder einem Streit mit der Schwiegermutter. Doch wann wird aus einem intensiven Nachdenken über ein unangenehmes Thema die eher problematische Angewohnheit des Grübelns? Und was kann ich tun, wenn ich tatsächlich […]
„Mut“ gilt in unserer Gesellschaft durchaus als eine Tugend. Er wird gefordert („Nur Mut!“), gefeiert, anerkannt … und oft vermisst. Aber was ist „Mut“ nun eigentlich? Mut zu besitzen mag eine persönliche Qualität sein, sie wird jedoch erst durch eine konkrete Entscheidung offenbar und bleibt sonst im Verborgenen. Es geht darum, in einer Situation Mut […]
Fast jeder erlebt es in irgendeiner Form: Fremde Menschen rempeln einen an, drängen sich vor, stehen im Weg oder greifen in wesentlich schlimmerer Form ins Leben Anderer ein … ohne es für nötig zu erachten, sich dafür zu entschuldigen. Ältere kommentieren solche Situationen meist etwas hilflos mit der Bemerkung „schlechte Erziehung“ oder einem allgemeinen Verweis […]
Im Rahmen des Projektes „Münsters Wissen schafft“ beleuchtet die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster unter anderem in einer ihrer Veranstaltungen auch das persönliche Glück des Menschen. Wovon hängt es ab? Wodurch wird es gefördert? Dabei kam eine der zentralen Fragen der heutigen Zeit zur Sprache: Sind Egoisten wirklich glücklicher? Und was hat es mit der Moral […]
„Du brauchst mir gar nichts vorzumachen. Ich sehe doch, wenn Du lügst.“ Das ist eine Standardaussage vieler Eltern ihren Kindern gegenüber, die auch gern in Partnerschaften eingesetzt wird, jeweils meist prophylaktisch, zur Einschüchterung. Aber kann man wirklich erkennen, wenn ein anderer lügt? – Die Antwortet lautet: Im Prinzip schon. Doch ist es nicht so einfach, […]